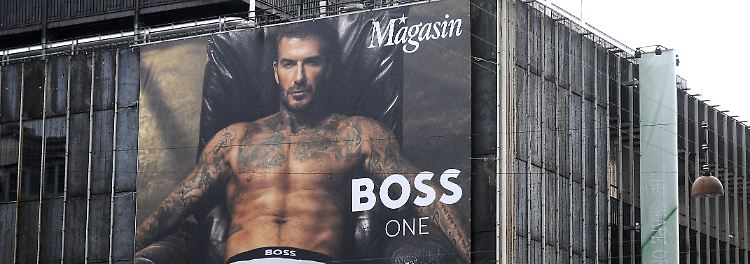Wenn ein Stein fällt, fallen auch andere Das Dominoprinzip der Weltwirtschaft
23.10.2012, 10:36 Uhr
Dr. Markus C. Zschaber
Nachdem die Geldflut die Märkte auf ein hohes Niveau geschwemmt hat, gehen die Kurse mit jeder neuen Euro-Krisenmeldung wieder zurück. Wie soll das langfristig weitergehen? Wenn Europa den Anpassungsprozess übersteht, könnte ein Paradigmenwechsel gelingen, glaubt Markus C. Zschaber.
Ein Blick zurück auf das Jahr 2012. Während im ersten Quartal 2012 die große Liquiditätsflut die Vermögenspreise von Aktien, Unternehmensanleihen & Co enorm hat steigen lassen, kam bereits im zweiten Quartal das Schreckgespenst der Systemkrise in der Eurozone wieder zurück in den Fokus des Markt – und Politikgeschehens.
Die Dramaturgie der Krise in der Eurozone spitzte sich rasant zu, Politiker aus allen europäischen Nationen brachten immer neue Lösungsvorschläge hervor, um ihre eigenen politischen Interessenslagen in den Blickpunkt zu rücken. Mehrstimmigkeit und Absurditäten führten zu hohen Dimensionen der politischen Inhomogenität in der Währungsunion. Der Nährboden für Spekulationen gegen die Finanzmärkte der Eurozone war geschaffen und nicht wenige Marktteilnehmer aus den USA und der City of London nahmen diese politische Vorlage an. Kapitalströme flossen aus Spanien, Griechenland und vielen anderen südeuropäischen Nationen, gleichzeitig versiegten Investitionsströme aus dem Ausland mit weiter zunehmender Dynamik.
Starkes Misstrauen in das europäische System war in allen großen Wirtschaftsräumen spürbar bzw. überall auf der Welt wahrzunehmen. Hinzu kam, dass sich die bereits fortschreitende Rezession in der südlichen Peripherie Europas nochmals massiv beschleunigte, um einen perfekten ökonomischen "Sturm" zu schaffen, der den Namen Depression trägt und von deflationistischen Entwicklungen immer wieder angefacht wurde.
Die Politik unterschätzte vollständig die Wirkungsketten ihres unzureichenden Krisenmanagements. Rückkopplungseffekte, welche diese erneut aufflackernde Systemkrise, die zuvor durch EZB–Geld stillgehalten wurde, hervorriefen, sind heute in vielen Teilen der Weltwirtschaft zu spüren. Das Vertrauen in die zyklischen, konjunkturellen Entwicklungen schien einmal mehr gestört zu werden und Zurückhaltung bei Investitionen standen erneut an der Tagesordnung. Die Kapitalmärkte verloren schnell das Vertrauen in Europa und genauso schnell in Asien. Die großen Marktteilnehmer aus den angelsächsischen Räumen brachten ihr Kapital "lieber" erst mal nach Hause, um es in Sicherheit zu wiegen.
Auf die Uneinigkeit in der europäischen Politik, bzw. die Uneinigkeit in einzelnen Regierungen und auf die zunehmende Spekulation gegen die Währungsunion bei gleichzeitig massiv gestörten Kapitalströmen, wurde die Europäische Zentralbank quasi gezwungen zu reagieren.
Im September 2012 kündigte die EZB ein "unbegrenztes" Programm zum Aufkauf von Anleihen an, um den Euro heil durch die Systemkrise zu bringen. Die Vorrichtungen für weitere Liquiditätsschleusen wurden umgesetzt. Die Reaktion darauf war, so wie sie immer war - kurzfristig zeigen solche Maßnahmen Wirkung und auch positive Kausalketten.
Wie geht es weiter?
Wie sieht es langfristig aus? Sollten die Volkswirtschaften in Europa den Anpassungsprozess wirklich stringent verfolgen können, ohne dass die Depression in Südeuropa eskaliert und eine Deflationsspirale in Gang setzt, könnte ein Paradigmenwechsel in Europa gelingen. Nicht wenige Regierungen erkennen, dass zügelloses Geldausgeben ein Ende haben muss und die Defizite der Vergangenheit sehr schädlich für die eigene Volkswirtschaft ausgehen können. Dies ist eine echte positive Wandlung und stützt die Glaubwürdigkeit der Währungsunion und sorgt für Vertrauen.
Wenn es der Politik gelingen sollte, dieses sich langsam aufbauende Vertrauen nicht zu konterkarieren, könnten die vorher negativen Rückkopplungseffekte für die Weltwirtschaft sich im positiven Sinn umkehren. Dies sollte dazu führen, dass die industriellen Kapazitäten sich erhöhen, vor allem in Deutschland. Daraus folgend könnte das Inflationsbild sich zunehmend nach oben hin anpassen.
Fakt ist, die Notenbanken rund um den Globus werden ihre Feuerkraft beibehalten, um zu versuchen, die Instabilitäten im westlichen Finanzsystem immer wieder auszugleichen. Die Geldmenge steigt durch die monetäre Basis, noch ist der Kanal zur Realwirtschaft nur bedingt offen. Bei positiver Konjunkturentwicklung sollte sich dies ändern. Unterm Strich sollte jeder Anleger seinen Blick in diesen Zeiten auch auf die strukturell gesünderen Volkswirtschaften richten, vor allem die der sogenannten Wachstumsmärkte.
Dr. Markus C. Zschaber ist leitender Fondsmanager der V.M.Z Vermögensverwaltungsgesellschaft (www.zschaber.de) . Gemeinsam mit dem Nachrichtensender n-tv veröffentlich das Institut auch monatlich den "Welt-Index" (www.weltindex.com) und "Welt-Handelsindex (www.welthandelsindex.de)
Quelle: Dr. Markus C. Zschaber Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH