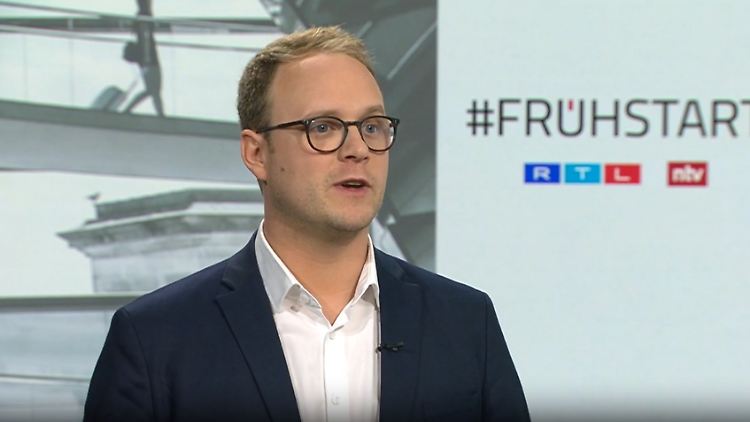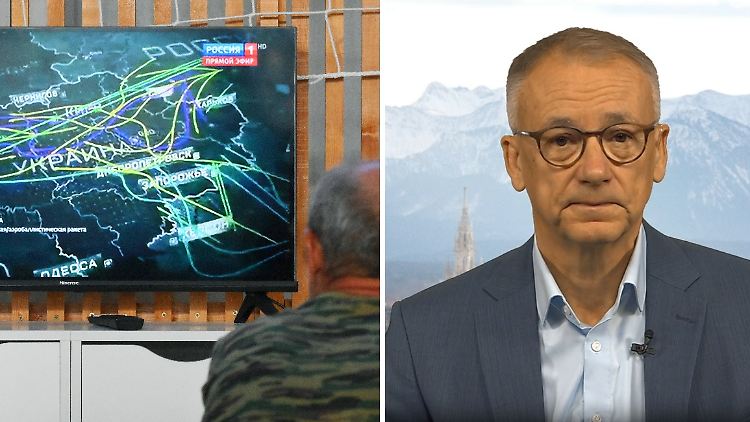Rückholaktion im Atomlager Asse Bergleute leisten riskante Pionierarbeit
01.04.2011, 17:02 UhrFür Atomexperten ist es ein weltweit einmaliges Manöver: Im maroden Atommülllager Asse sollen die entsorgten Abfallfässer aus der Tiefe geholt werden. Nach langwierigen Tests wollen die Fachleute jetzt einen Blick auf die eingeschlossenen Fässer werfen. Dazu fehlt ihnen noch die Erlaubnis.
In 490 Meter Tiefe stoppt der Förderkorb. Über eine Strecke von 3,4 Kilometern geht es mit dem Geländewagen weiter in die Tiefe des alten Salzbergwerkes Asse bei Wolfenbüttel. Die Entsorgung von Atommüll in der instabilen Grube gilt als eine der größten Umweltsünden in Deutschland. 750 Meter unter der Erde soll sich demnächst ein Spezialbohrer durch die etwa 40 Meter dicke Wand arbeiten, hinter der einige tausend Fässer mit radioaktiv strahlendem Abfall lagern. Den Fachleuten des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS/Salzgitter) steht ein weltweit bisher einmaliges Manöver bevor.
Sie wollen rund 126.000 Atommüll-Fässer, von denen etliche beschädigt sein dürften, aus der Asse wieder herausholen - aber das Bergwerk droht wegen Wassereinbrüchen abzusaufen. Das Unterfangen, das Milliarden kostet, ist damit ein Wettlauf gegen die Zeit. Doch noch ist es längst nicht so weit - denn vor einer Bergung des Jahrzehnte alten Atommülls stehen erst einmal Probebohrungen in zwei Lagerkammern bevor.
Als Endlager missbraucht
Die Asse zeigt deutlich, dass die Endlagerung des Atommülls nach wie vor eines der größten Probleme ist. Nach dem Ende des Salzabbaus wurde die Asse als Forschungsbergwerk für die Endlagerung deklariert. Erst Jahrzehnte später stellte sich heraus, dass die Asse als Endlager missbraucht wurde. "Für Forschung hätte man keine 126.000 Fässer einlagern müssen. Zudem müsste dringend geklärt werden, ob das damals verantwortliche Helmholtz-Zentrum München in der Asse überhaupt geforscht hat", erläuterte BfS-Sprecher Werner Nording.

126.000 Fässer mit radioaktivem Müll müssen aus 13 Kammern zurückgeholt werden.
(Foto: picture alliance / dpa)
Zehn Zentimeter misst der Durchmesser des Bohrgangs, durch den die Fachleute mit Sonden einen ersten Blick auf den Zustand der Fässer werfen wollen - schon das ist für Ingenieure und Politiker eine Herausforderung.
"Wir stehen in den Startlöchern", sagt Bergmann Torsten Lothes. Doch noch fehlt die Genehmigung aus dem Umweltministerium in Hannover. Seit vergangenem September haben Lothes und seine fünf Kollegen - zunächst fernab der Atomfässer - ausgelotet, wie sie sich am sichersten den Fässern nähern können, die in fein gemahlenem Steinsalz und hinter dicken Mauern lagern. Sowohl das technische Gerät als auch die Vorgehensweise mussten erprobt werden. "Das ist hier Pionierarbeit", erzählt Projektleiter Gisbert Terbach.
Von Ängsten wollen die Bergleute nichts wissen. "Wir sind gut geschult und vertrauen der Technik, wir haben sie ja auch mit ausbaldowert", sagt Lothes. Sein Kollege Vitali Deiss fügt mit Stolz hinzu: "Das zentimetergenaue Bohren ist eine Herausforderung. Die hier entwickelten Geräte können weltweit angewendet werden."
Niemand kennt den Zustand des Atommülls
Für das Verfahren müssen besonders hohe Sicherheitsmaßstäbe gelten. Das verantwortliche Bundesamt für Strahlenschutz konnte nicht wie ursprünglich geplant schon Ende des vergangenen Jahres mit ersten Arbeiten beginnen. BfS-Präsident Wolfram König warnte kürzlich auch vor einer Verzögerung durch zu hohe Auflagen. Und auch der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel, in dessen Wahlkreis das Lager liegt, hat unlängst den Umweltministerien des Bundes und des Landes mangelnde Unterstützung bei der Räumung des Atommülllagers Asse vorgeworfen. "Das Bundesamt für Strahlenschutz könnte schneller arbeiten, hat aber nicht genug Unterstützung aus Berlin und Hannover", sagte Gabriel.

In einem ungefährlichen Bereich des einsturzgefährdeten Schachts wurden Probebohrungen vorgenommen.
(Foto: picture alliance / dpa)
Doch die Fachleute der Umweltministerien von Bund und Land sprechen derzeit noch über die genauen Genehmigungsbedingungen. Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel warf den Häusern mangelnde Unterstützung bei der Räumung des Atomlagers vor. "Unser Ziel ist die sichere Schließung der Asse. Das geht nach allem was wir wissen nur dadurch, dass wir die Abfälle zurückholen", sagt BfS-Chef König.
In der Asse gibt es 131 durch Salzabbau entstandene Kammern; in 13 von ihnen liegt Atommüll. In zwei dieser Lagerkammern wollen die Experten möglichst schnell einen Blick werfen, denn bislang kennt niemand den aktuellen Zustand der teils wild hinein gekippten Fässer. Zudem hat sich das Gebirge seit der Einlagerung des Mülls zwischen 1967 und 1978 bewegt. Möglicherweise sind die Fässer zusammengedrückt - was eine Bergung erschweren würde.
Zudem ist bis heute nicht genau bekannt, was dort unten alles liegt. Sollten etwa Versuchstiere oder andere organische Stoffe zu finden sein, könnten Faulgase entstehen und beim Anbohren dadurch die Gefahr einer Explosion. "Wir schätzen diese Gefahr allerdings als sehr gering ein", sagt BfS-Sprecher Werner Nording.
"Wir haben keine Angst"
Dennoch seien ausreichend Vorkehrungen getroffen. Projektleiter Terbach erläutert: "Für eine Explosion sind Sauerstoff, ein brennbares Gas und ein Zündfunke notwendig." Um den Funken zu verhindern, drehen sich die Spezialbohrer nur so schnell, dass sie höchstens 56 Grad warm werden. Sollten brennbare Gase wie etwa Wasserstoff festgestellt werden, würde sofort Stickstoff in die Kammer eingeleitet, der das Gas durch einen chemischen Prozess in einen nicht brennbaren Stoff umwandle.
Auch vor der Gefahr radioaktiver Strahlen fühlen sich die Bergleute dank vorgesehener Messungen und anderer Vorkehrungen ausreichend geschützt. "Wir haben keine Angst, aber Respekt. Wie in jeder Grube muss man mit dem Auge und dem Verstand dabei sein", sagt Bohrhauer Lothes.
Quelle: ntv.de, Anita Pöhlig und Monika Wendel, dpa