Interview mit Patientenschützer Brysch"Die Organspende muss in staatliche Hände"
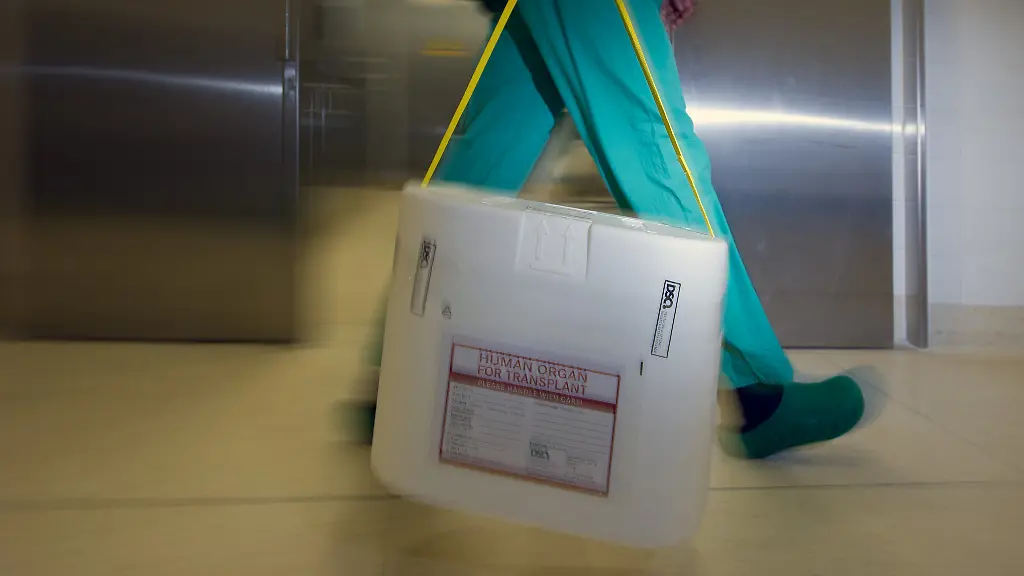
Bei der Regelung der Organspende gehe es um Fragen von Sterben oder Weiterleben, sagt der Chef der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch. "Es geht um Gerechtigkeitsfragen. Und für diese Fragen sieht unsere Verfassung nur ein legitimiertes Gremium vor: den Deutschen Bundestag."
Bei der Regelung der Organspende gehe es um Fragen von Sterben oder Weiterleben, sagt der Chef der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch. "Es geht um Gerechtigkeitsfragen. Und für diese Fragen sieht unsere Verfassung nur ein legitimiertes Gremium vor: den Deutschen Bundestag."
n-tv.de: Die Skandale um manipulierte Transplantationen haben dafür gesorgt, dass die Zahl der Organspenden im vergangenen Jahr um knapp 13 Prozent zurückgegangen ist. Können Sie mir guten Gewissens empfehlen, einen Organspendeausweis auszufüllen?
Eugen Brysch: Es ist bei unserer Patientenberatung immer schwieriger, die Menschen von der Wichtigkeit des Organspendeausweises zu überzeugen. Wir stecken in der tiefsten Vertrauenskrise seit Beginn der Transplantationen in Deutschland. Das heißt: Die privaten Akteure, Bundesärztekammer, Deutsche Stiftung Organtransplantation und Eurotransplant haben uns in die Krise geführt. Deshalb muss die Politik Verantwortung übernehmen. Bundestag und Bundesgesundheitsminister müssen die Frage der Organspende in staatliche Hände legen. Schließlich geht es hier um Fragen von Sterben oder Weiterleben. Eine ethische Frage, die nicht medizinisch zu lösen ist.
Sie haben die drei zuständigen Organisationen genannt: die Deutsche Stiftung Organtransplantation als Koordinationsstelle, die Bundesärztekammer, die die Regeln und die Aufsicht organisiert, und die niederländische Stiftung Eurotransplant als Vermittlungsstelle. Ist es sinnvoll, private Organisationen mit einem Thema zu betrauen, bei dem es um Leben und Tod geht?
Das ist überhaupt nicht sinnvoll. Es kann nicht sein, dass immer die gleichen Akteure Regeln festsetzen, diese umsetzen und überprüfen.
Zurückgegangen ist nicht nur die Zahl der Spender, sondern auch die Zahl der Patienten auf den Wartelisten für eine Organspende. Woran könnte das liegen?
Die Antwort darauf müssen uns die Bundesärztekammer und Bundesgesundheitsminister Bahr geben. Schließlich setzt die Bundesärztekammer die Regeln fest und der Minister verantwortet sie. Die Begründung des Eurotransplant-Chefs Axel Rahmel, dass die Schwerstkranken selbst für den Rückgang verantwortlich sind, ist wenig überzeugend. Nicht die Patienten setzen sich selbst auf die Warteliste, sondern die verantwortlichen Transplantationsärzte. Und da sich an den Regeln für die Aufnahme auf die Warteliste nichts geändert hat, gibt es aus Patientensicht zwei Möglichkeiten: Entweder sind die Regeln doch nicht so klar und zwingend wie uns die Bundesärztekammer weismachen will oder die meldenden Transplantationsärzte schauen bei der medizinischen Einordnung jetzt anders hin.
Wie kann überhaupt entschieden werden, wer eine Niere oder eine Leber bekommen soll? Ist es ethisch vertretbar, einem Alkoholiker eine Leber zu verweigern oder einem älteren Menschen ein Herz?
Damit ist das ethische Problem auf den Punkt gebracht. Es ist nicht medizinisch begründbar, warum man sechs Monate "trocken" sein muss, um eine neue Leber zu erhalten. Warum sind es nicht ein Jahr, drei Jahre oder fünf Jahre, die als Nachweis für die Alkoholabstinenz entscheidend sind? Warum wird bei der Leber allein auf das Merkmal Dringlichkeit gesetzt, obwohl das Transplantationsrecht vorschreibt, dass Erfolgsaussicht und Dringlichkeit gleichwertig sind? Wie wir sehen, ist das medizinisch nicht zu lösen. Es geht um Gerechtigkeitsfragen. Und für diese Fragen sieht unsere Verfassung nur ein legitimiertes Gremium vor: den Deutschen Bundestag.
In Göttingen steht derzeit der frühere Leiter des dortigen Transplantationszentrums vor Gericht, er soll seinen Patienten Organe verschafft haben. Die elf Menschen, denen er gegen die Regeln eine Leber verschafft haben soll, leben noch. Ist es nicht richtig, dass ein Arzt sich für seine Patienten einsetzt?
Es ist immer richtig, dass sich ein Arzt für seine Patienten einsetzt. Er muss sich aber - wie jeder andere auch - an verbindliche Regeln halten. Ein ungeregeltes Verhalten endet immer in Zügellosigkeit und Willkür. Deshalb steht in Göttingen auch das Transplantationsrecht "vor Gericht": Darf ein privater Verein wie die Bundesärztekammer verbindliche Regeln für elementare Fragen des Grundrechts auf Leben treffen? Schließlich wird die Straßenverkehrsordnung ja auch vom zuständigen Ministerium und nicht vom ADAC erlassen.
Es gab nach den Organspende-Affären ein paar Gesetzesänderungen, unter anderem gilt bei der Aufnahme auf die Wartelisten jetzt das Sechsaugenprinzip. Reicht das aus?
Das Sechsaugenprinzip hätte zum Beispiel in Göttingen nichts gebracht. Die Zeugenaussagen der Mitarbeiter des Transplantationszentrums machen deutlich: Angst, Anpassung und Wegschauen waren an der Tagesordnung. Das Ganze wurde offenbar gedeckt von der Leitung des Universitätsklinikums, und die Deutsche Stiftung Organtransplantation schaute dieser Gutsherrenart zu. Aber die Gesetzesänderung bringt etwas tatsächlich Neues. Künftig ist der Bundesgesundheitsminister verantwortlich für das Aufstellen und Durchsetzen der Richtlinien. Mit dem Genehmigungsvorbehalt seines Hauses hat er auch die Konsequenzen zu tragen.
Heute ist der Prüfbericht der Bundesärztekammer zu den Lebertransplantationen vorgestellt worden. Ergebnis: Es gab Unregelmäßigkeiten, aber keinen Skandal. Ist damit alles in Ordnung?
Ich halte nichts von Skandalisierung. Es geht nicht darum, für kurze Zeit ein Thema in der Öffentlichkeit aufzubauschen. Als Patientenschützer kritisieren wir seit vielen Jahren das Transplantationssystem in Deutschland. Schon weit vor den Vorfällen haben wir auf die mangelnde Transparenz hingewiesen und die politische Verantwortung angemahnt. Jeden Tag wird es schwieriger in der Patientenberatung, die Menschen von der Wichtigkeit der Organspende zu überzeugen. Bisher wurden die Ängste und Vorbehalte von den Akteuren des Systems ignoriert. Ich habe die Sorge, dass die notwendige radikale Wende nicht kommen wird. Der Prüfbericht nährt diese Sorge. Richtlinienverstöße bleiben Verstöße. Jetzt eine neue Kategorie einzuführen und zwischen systematischen und nicht-systematischen Verstößen zu unterscheiden, stärkt in mir die Befürchtung, dass die grundsätzlichen Änderungen weiter ausbleiben.
Mit Eugen Brysch sprach Hubertus Volmer