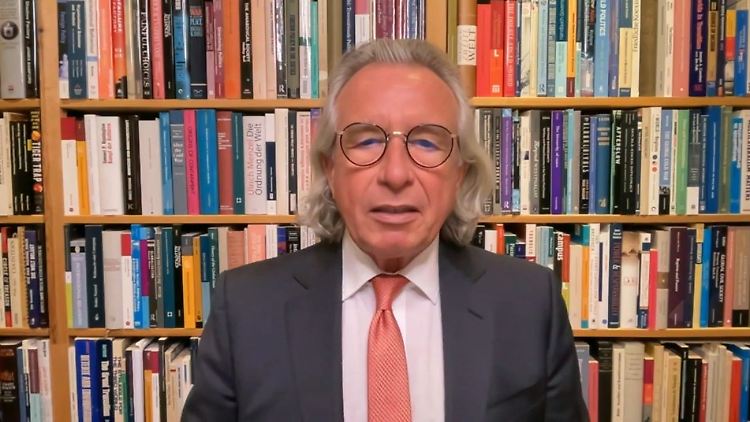Gegen Staat und Naumann Euro-Rebell will FDP-Stiftung umbenennen
14.07.2014, 10:44 Uhr
Frank Schäffler plädiert für einen radikalen Liberalismus.
(Foto: picture alliance / dpa)
Bevor die FDP sich umbenenne, solle lieber ihre Stiftung einen anderen Namen annehmen, fordert der FDP-Politiker Schäffler. Es geht um das Verhältnis seiner Partei zum Staat.
Der ehemalige FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler fordert eine Umbenennung der parteinahen Friedrich-Naumann-Stiftung. "Naumann war mindestens Sozialist und Militarist, aber mit Sicherheit kein Liberaler", sagte Schäffler dem "Handelsblatt".
Die Stiftung wurde 1958 gegründet, 2007 bekam sie den Namenszusatz "für die Freiheit". Schäffler, der sich einen Namen als Euro-Rebell gemacht hat, will, dass sie künftig nur noch "Stiftung für die Freiheit" heißt.
Naumann war ein liberaler Politiker und lebte von 1860 bis 1919. Für Schäffler war er "der Totengräber des deutschen Liberalismus bis zum Beginn der Weimarer Republik", sein Wirken "vergiftet bis heute den organisierten Liberalismus in Deutschland". Naumann habe an "die Übermacht des Staates" geglaubt, "der lenkt, formt und für Dritte entscheidet". Dieser Glaube "zersetzt" die FDP noch heute, so Schäffler.
Schäffler empfiehlt der FDP, sich der Tradition von Eugen Richter und Hermann Schulze-Delitzsch zuzuwenden, liberalen Politikern aus dem 19. Jahrhundert also, die staatliche Interventionen rigoros ablehnten. Schulze-Delitzsch habe gezeigt, "wo der methodische Weg für die FDP hingehen muss: zu einer Graswurzelbewegung aus praktizierter Selbsthilfe statt einem immer mehr umverteilenden Wohlfahrtsstaat", so Schäffler.
Der Historiker Götz Aly hatte bereits in einem 2011 erschienen Buch über die Geschichte des Antisemitismus in Deutschland darauf hingewiesen, dass Naumann als Wegbereiter des Nationalsozialismus gelten könne, auch wenn er kein Vordenker von Hitlers Antisemitismus gewesen sei. Naumann habe allerdings "soziale, imperiale und nationale Gedanken zu einer geschlossenen Geistesströmung" vermengt, "die sich am Ende mit dem Gedankengut der NSDAP vermischen konnte". In der "Berliner Zeitung" schrieb Aly damals, wer Naumann lese, begreife, "warum die fünf liberalen Abgeordneten des Reichstags, darunter Theodor Heuss und Ernst Lemmer, am 24. März 1933 Hitlers Ermächtigungsgesetz zustimmten, und zwar mit dieser Begründung: 'Wir fühlen uns in den großen nationalen Zielen durchaus mit der Auffassung verbunden, wie sie heute vom Herrn Reichskanzler hier vorgetragen wurde.'" In einer Broschüre der Naumann-Stiftung heißt es nur lapidar, Antisemitismus sei Naumann "nicht gänzlich fremd" gewesen.
Quelle: ntv.de, hvo