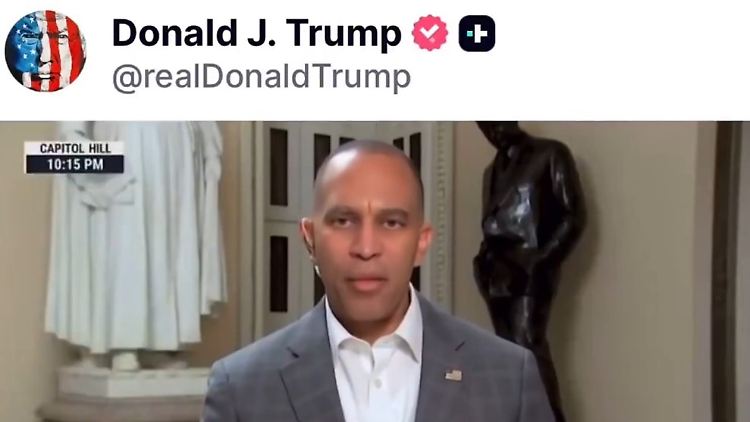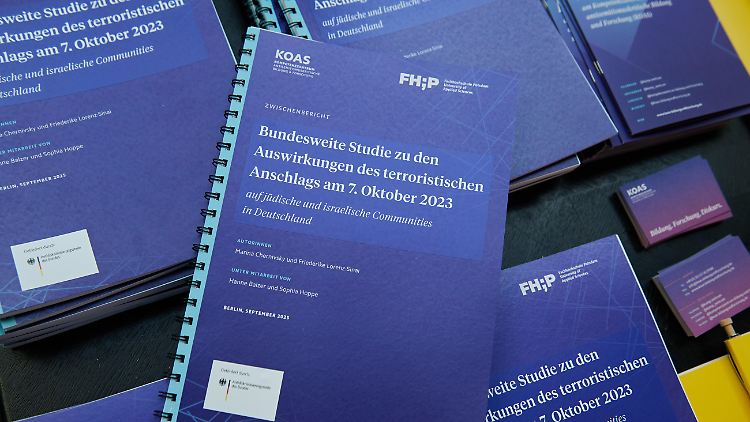Experten: Laufzeiten bringen Milliarden Konzerne drohen mit Stilllegung
25.08.2010, 07:51 Uhr
Kernkraftwerke an der Isar: Noch ist nicht klar, wie lange sie am Netz bleiben dürfen und was das die Betreiber kostet.
(Foto: dpa)
Im Streit um die Milliarden-Abgaben für die längeren Laufzeiten von Atomkraftwerken droht EnBW-Chef Villis erneut mit der Abschaltung von Kraftwerken. Sollten sie nicht mehr wirtschaftlich sein, bleibe keine andere Wahl. Experten sehen allerding noch Spielraum: Die Konzerne könnten schließlich mit Zusatzgewinnen von sechs Milliarden Euro im Jahr rechnen.
Im Streit um längere Laufzeiten von Atomkraftwerken und damit verbundene Abgaben für Kernkraftwerksbetreiber schließt der Chef des Energiekonzerns EnBW, Hans-Peter Villis, das Abschalten einzelner Anlagen nicht aus. "Wir haben der Politik nie damit gedroht, Kernkraftwerke stillzulegen. Aber es muss auch für uns der Grundsatz gelten dürfen, dass wir Anlagen nur betreiben, wenn das betriebswirtschaftlich dauerhaft sinnvoll ist", sagte er dem "Handelsblatt". Wenn das nicht mehr möglich sei, bleibe keine andere Wahl, als eine Stilllegung von Anlagen zu prüfen.
Villis reagierte damit auf die Signale der Bundesregierung, neben einer Brennelementesteuer in Höhe von 2,3 Milliarden Euro jährlich von den vier Kernkraftwerksbetreibern zusätzlich Beiträge zum Ausbau der erneuerbaren Energien zu verlangen. Über Umfang und Ausgestaltung dieser Beiträge herrscht im Moment noch Unklarheit. "Die Gemengelage ist für uns unübersichtlich", sagte Villis. Die zum Teil widersprüchlichen Aussagen seien ein Problem. "Etwas mehr Verlässlichkeit würde helfen", sagte der EnBW-Chef.
"Spielraum nach oben"
Die geplante Brennelementesteuer sollte nach Meinung von Experten überwiegend für den Umbau des Energiesystems verwendet werden. "Die Einnahmen ausschließlich in die Haushaltskonsolidierung zu stecken, ist der falsche Weg", sagte die Energieexpertin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Claudia Kemfert, der "Rheinischen Post". "Die Regierung sollte sich auf ihre im Koalitionsvertrag festgelegte Absicht besinnen und das Geld zum größten Teil in den Umbau des Energiesystems investieren."
Nach Einschätzung Kemferts würden auch zusätzliche Abgaben die Energiekonzerne nicht überfordern. "Für die Zusatzgewinne sind durchschnittlich sechs Milliarden pro Jahr eine realistische Größenordnung. Der Staat kann also mehr als die 2,3 Milliarden Euro abschöpfen, da gibt es Spielraum nach oben."
Niedersachsen fordert Anteil
Niedersachsens Ministerpräsident David McAllister forderte unterdessen, einen Teil der geplanten Brennelementesteuer an die Bundesländer zu zahlen. "Wir Niedersachsen haben ein Interesse daran, dass weitere Mittel in die Erforschung von Speichertechnologien und erneuerbare Energien fließen", sagte McAllister der "Financial Times Deutschland". Die niedersächsische Landesregierung lasse ihre Juristen prüfen, welcher Anteil des Geldes den Ländern zustehen könnte.
McAllister verwies darauf, dass Niedersachsen führend in der Windkraft sei. Zudem sei das Land mit den drei Atomlager-Standorten Asse, Konrad und Gorleben stark durch die Atomenergie belastet. "Wir tragen deshalb besondere Lasten und einen erheblichen Teil der Verantwortung in Sachen Energie." Dies sei Grund genug, um einen besonders großen Anteil an den Zahlungen der Energieversorger zu beanspruchen.
Bislang ist allerdings noch nicht klar, ob die Brennelementesteuer wirklich kommt oder stattdessen eine Alternativabgabe erhoben wird. Offen ist auch noch, ob darüber hinaus eine zusätzliche Abgabe von der Atomwirtschaft gefordert wird, die dann möglichst in erneuerbare Energien fließen soll. In Teilen der Union wird eine von der Atomwirtschaft favorisierte Vertragslösung bevorzugt. "Es ist nichts entschieden", sagte eine Sprecherin des Umweltministeriums in Berlin. Ende September will die Regierung ein Energiekonzept vorlegen.
Quelle: ntv.de, dpa