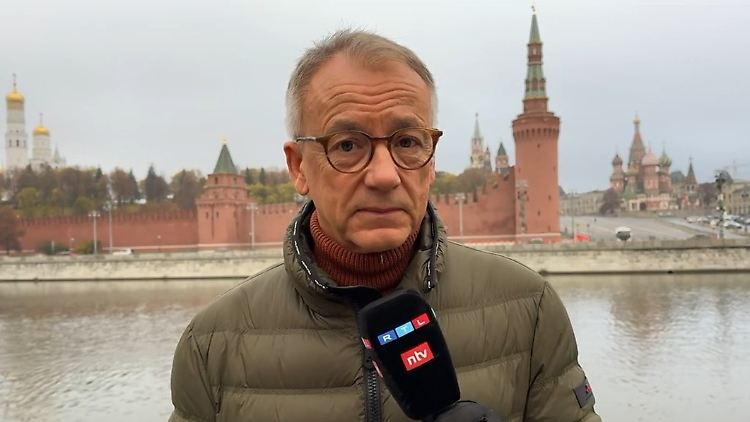Holocaust-Gedenken in Auschwitz Politik statt Tränen
27.01.2014, 18:59 Uhr
Über diese Gleise rollten die Transporte des Todes. Züge brachten täglich neue Häftlinge und Todgeweihte.
Vor genau 69 Jahren befreiten die Sowjets das Vernichtungslager Auschwitz. Jedes Jahr kommen noch lebende Ex-Häftlinge zurück, jedes Jahr werden es weniger - die politischen Parolen sind heute dafür umso schärfer.
Der Weg des Gedenkens führt durch ein Spalier israelischer Flaggen. Mitglieder einer ranghohen Delegation haben sie mit nach Auschwitz gebracht und lassen den Strom der Ehrengäste unter ihnen hindurch spazieren. Das halbe israelische Parlament ist zu Besuch im ehemaligen Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, dem Schicksalsort der Juden, der vor genau 69 Jahren durch die Rote Armee befreit wurde. 61 israelische Parlamentsabgeordnete sind an diesem eisig kalten Montag in den Süden Polens gekommen. Sie verwandeln die Feier der Tränen in eine höchst politische Veranstaltung, die ob ihrer scharfen Botschaften beinahe ohne Momente der stillen Trauer auskommt.
Schon am Morgen heulen über der Gedenkstätte Polizeisirenen, die an einen amerikanischen Fernsehfilm erinnern. Zum ersten Mal in der Geschichte des Gedenkens reist eine so große Delegation israelischer Politiker nach Auschwitz. Begleitet von einer Gruppe Überlebender besichtigten die Parlamentarier noch am Mittag beide Gedenkstätten, das Stammlager und das Lager Birkenau. Auch fast 60 polnische Parlamentarier gedachten der Toten, mehr als ein Dutzend Botschafter machten ihre Aufwartung und das Programm dieses Holocaustgedenktages zu einem wahren Staatsakt.
"Wir sind die stolzen Bürger Israels"
Dem Auschwitz-Überlebenden Noah Klieger gebührten die ersten Worte der Feier - und er gab mit scharfen politischen Parolen die Richtung vor. Mitten auf dem Gelände des Vernichtungslagers, in dem an manchen Tagen mehrere Tausend Häftlinge vergast wurden, rief Klieger voller Inbrunst und Stolz: "Hier sind wir wieder. Wir sind die stolzen Bürger Israels." Seine heutige Heimat, den jüdischen Staat, bezeichnete der 87 Jahre alte Publizist als eines der am besten entwickelten Länder der Welt. Seine wichtigsten Worte, die Erinnerungen an die Zeit der Unterdrückung und Erniedrigung durch die Nazis, verkamen beinahe zur Randnotiz.
Der Knesset-Abgeordnete und israelische Oppositionsführer Isaak Herzog wurde noch deutlicher. Er rief dazu auf, jedem Juden einen Platz zu bieten, wo er sicher sein kann. Auch diese Äußerung muss als eine klare Forderung an die Welt verstanden werden, dem Staat Israel enger beizustehen.
Auch andere Redner des Tages kümmerten sich um ihre tagespolitischen Befindlichkeiten. Der Vizepräsident der polnischen Parlamentskammer Sejm, Cezary Grabarczyk, warnte vor schweren sprachlichen Fehlern in der Erzählung über Auschwitz. "Pure Ignoranz", schimpfte Grabarczyk, sei der immer wieder auftauchende Begriff des "polnischen Konzentrationslagers". "Das ist ein Ignorieren der historischen Wahrheit", sagte der Parlamentsvize. Polen sei ein Opfer des Holocaust und des nationalsozialistischen Terrors geworden - auf dem eigenen Territorium.
Gegenwartspolitik contra Gedenken
Die Holocaust-Erinnerung ist hochpolitisch, doch die Politik der Gegenwart und ihre politischen Köpfe nehmen immer mehr Raum ein. Von Jahr zu Jahr können weniger Überlebende kommen, ihren Raum nehmen Politiker offenbar dankend ein. Die meisten der früheren Inhaftierten sind hochbetagt und falls sie heute noch leben, sind ihnen die Strapazen der Reise oft nicht mehr zuzumuten. Ignacy Golik machte sich trotz seiner 92 Jahre auf den Weg von Warschau in das rund 300 Kilometer entfernte Auschwitz. Im Jahr 1941 verhaftete ihn die Gestapo, die Nazis deportierten Golik nach Auschwitz, verlegten ihn im November 1944 nach Sachsenhausen und später nach Barth an die Ostsee, wo er für den Flugzeughersteller Heinkel zur Arbeit gezwungen wurde. Golik überlebte die kräftezehrenden Jahre - ganz genau kann heute niemand mehr begreifen, wie er Schläge, Erniedrigung und härteste Arbeit ertrug.
Aus ihm wurde ein Zeitungsreporter und ein eindrucksvoller Mittler zwischen den Generationen. Als ihn eine junge Französin um ein Gespräch bittet, lässt es sich Golik nicht nehmen, sogleich Komplimente zu machen. Die 20-jährige Valentine errötet und allen Umstehenden ist klar: Ignacy Golik ist heute zu stark, um noch Hass, Verachtung oder Verbitterung zu spüren. Sein Deutsch ist noch immer erstaunlich gut, Golik braucht keinen Dolmetscher, als er von seiner Zeit in Auschwitz erzählt. Wer ihn fragt, an was er sich besonders lebhaft erinnert, der bekommt eine schaurige Demonstration. Goliks Augen blitzen auf, sein Oberkörper streckt sich: "Sie sind in einem deutschen Konzentrationslager", zischt er in einem scharfen Ton. Genau so erlebte er es an vielen Tagen, wenn der KZ-Leiter neue Häftlinge begrüßte. Häftlinge, die gebracht wurden, um brutal zu verrecken.
Quelle: ntv.de