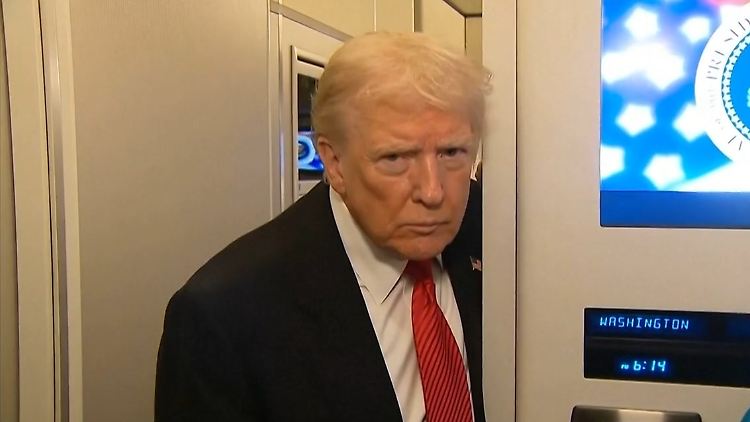Deregulierung im Wahlkampf "Spalter-Themen sind vorbei"
14.10.2008, 09:01 Uhr"Bislang ging es in Wahlkämpfen oft um die so genannten Werte-Themen", sagt der Politologe Thomas Greven im Gespräch mit n-tv.de: "Abtreibung, Waffenbesitz, Homo-Ehe; Spalter-Themen, mit denen die Republikaner lange sehr erfolgreich waren." Die Finanzkrise sorge dafür, "dass viele Wähler wieder ihre ökonomischen Interessen entdecken".
n-tv.de: In diesem Präsidentschaftswahlkampf stehen sich zwei ziemliche Außenseiter gegenüber: Barack Obama wäre der erste schwarze US-Präsident, John McCain der bei Amtsantritt älteste. Können Sie sich an einen Wahlkampf erinnern, der ähnlich ungewöhnlich war?
Thomas Greven: Ich finde nur einen der beiden Kandidaten ungewöhnlich. McCains Alter spielt zwar eine Rolle, aber ein Außenseiter ist er nur aufgrund von Selbststilisierung und Medienhype.
Sie halten ihn nicht für den "maverick", als den er sich ständig bezeichnet?
Nicht so sehr, nein. Dieses Etikett ist nicht ganz unverdient, aber es ist doch zum größten Teil inszeniert. Für ihn ist das sinnvoll, denn die Amerikaner lieben die Außenseiter. Jimmy Carter zum Beispiel: Nach Watergate, nach dem Vietnamkrieg kam dieser Erdnussfarmer aus Georgia, mit dem keiner gerechnet hatte. Die Geschichte vom Außenseiter ist eine Variante des alten Blockhüttenmythos - der amerikanische Traum von den einfachen Leuten, die sich hochgearbeitet haben. Bill Clinton war ein legitimes Beispiel dafür, Barack Obama vielleicht auch, obwohl er das nicht sehr betont.
Was die Amerikaner auch lieben, ist der Appell an die Überparteilichkeit. Selbst George W. Bush hat seine beiden Regierungszeiten so begonnen - noch in seiner Antrittsrede nach der Wahl 2004 versprach er, Spaltungen zu "heilen".
Die Spaltung der Vereinigten Staaten wird im Moment sehr breit diskutiert: Wir haben eine sehr starke Parteilichkeit in einem System, das eigentlich keine strenge Fraktionsdisziplin kennt, wo Mehrheiten meist überparteilich hergestellt werden. Das begann Mitte der 90er Jahre mit der entschlossenen Führung der Republikaner durch Newt Gingrich und es hat sich immer weiter verschärft. Zugleich zeigen Umfragen, dass die Amerikaner sich so uneinig nicht sind in vielen Fragen. Unter anderem hat das damit zu tun, wie die Wahlkreise geschnitten werden. Das ist Sache der Parlamente in den Einzelstaaten. Und die sorgen dafür, dass immer mehr Wahlkreise so geschnitten sind, das sie kaum noch verloren gehen können.
Wie oft werden die Wahlkreise denn neu zugeschnitten?
Alle zehn Jahre, nach dem jeweils neuen Zensus. In Texas gab es sogar außerhalb dieses Zehnjahresrhythmus einen erfolgreichen Versuch, Wahlkreise neu zu schneiden - zugunsten der Republikaner. Dabei passiert folgendes: Menschen werden in einem Wahlkreis vereint, die im Schnitt extremer denken als der Durchschnitt der Bevölkerung in dem Bundesstaat insgesamt.
Die Finanzkrise ist das Hauptthema des Wahlkampfes geworden. Wie ist die Stimmung bei den Wählern: Werden die "trickle-down-economics", die Obama so scharf kritisiert, in den USA mittlerweile mehrheitlich abgelehnt?
Im Moment schon.
Die Demokraten machen immerhin Wahlkampf damit, McCain als jemanden darzustellen, der im Senat meist für Deregulierung gestimmt hat.
Das hat schon etwas Heuchlerisches. Auch die Clinton-Regierung hat dereguliert, und im Kongress haben die Demokraten auch in der Zeit der Bush-Regierung keinen entschlossenen Widerstand gegen Deregulierung geleistet. Obama selbst hat Berater von der Wall Street in seinem Team. Positiv ist, dass die Finanzkrise dafür sorgt, dass viele Wähler wieder ihre ökonomischen Interessen entdecken. Bislang ging es in Wahlkämpfen oft um die so genannten Werte-Themen: Abtreibung, Waffenbesitz, Homo-Ehe; Spalter-Themen, mit denen die Republikaner lange sehr erfolgreich waren.
Ist der Neoliberalismus in den USA auf dem Rückzug?
Die Haltung, nicht nur einzelne Manager für die Krise verantwortlich zu machen, sondern das System insgesamt, gibt es zwar durchaus. Aber man wird abwarten müssen, wie sich das entwickelt. Die Europäer neigen dazu, die jeweils amtierende Regierung für Fehlentwicklungen verantwortlich zu machen. Bei den Amerikanern ist es der Staat insgesamt, der mit Skepsis betrachtet wird. Deshalb bin ich nicht sicher, ob Obama am Ende wirklich so stark von der Finanzkrise profitieren wird. In jedem Fall würde ein Präsident Obama schnell herausfinden, dass sich die Staatsskepsis auch gegen ihn selbst wenden wird.
Angenommen, Obama macht das Rennen: Seine Anhänger erwarten "change". Aber wie viel Wandel kann ein US-Präsident überhaupt bewirken? Wie viel Macht hat der mächtigste Mann der Welt?
Das ist die große Frage. Ich glaube, diese Wahl kann eine Enttäuschungsfalle werden, weil so viel Hoffnung aufgebaut wird, dass ein einzelner Mann im Weißen Haus das nicht erfüllen kann. Vieles wird davon abhängen, ob die Demokraten auch im Senat eine gestalterische Mehrheit erringen können; am 4. November wird ja auch ein Drittel des Senats neu gewählt. Dort brauchen die Demokraten eine "filibuster-proof majority", eine Mehrheit, mit der sie Blockadeversuche der Republikaner abwehren können. Diese Mehrheit liegt bei 60 zu 40, eine Minderheit von 41 Senatoren kann alles blockieren. Die andere Frage ist, wie sehr Obamas Anhänger sein "Yes We Can" als "we" und nicht als "I" verstanden haben. Wenn seine Anhänger ihre Aufgabe als erledigt ansehen, wenn Obama im Weißen Haus ist, dann hätte er ein Problem. Wenn Obama gewählt wird, muss er versuchen, die Präsidentschaft als - wie Theodore Roosevelt das formuliert hat - "bully pulpit" zu benutzen, als Kanzel, von der aus er Themen setzt.
Und? Kann er das schaffen?
Hier liegt seine Stärke. Sein Programm ist an vielen Stellen unklar, schwach oder gar enttäuschend, etwa bei der Gesundheitspolitik. Obamas Stärke ist eine sehr hohe Glaubwürdigkeit. Mit seiner Biographie verkörpert er geradezu das amerikanische Staatsmotto: die Einheit in der Vielfalt. So stilisiert er sich in seinen Reden und in seinen Büchern, und so könnte er es schaffen, sich Roosevelts Kanzel anzueignen. Mit Blick auf die Finanzkrise wurde häufig gesagt, jetzt bräuchten wir einen, der in der Lage ist, den einen Satz zu sagen, der alle wieder beruhigt. In der Great Depression, der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre, kam der andere Roosevelt, FDR, und sagte, das einzige, vor dem wir Angst haben müssen, ist die Angst selbst. Natürlich hat dieser eine Satz nicht die Krise beendet, aber man darf Symbolpolitik nicht unterschätzen. Es gibt ein starkes Bedürfnis nach Symbolen - daher auch der Vergleich zwischen Obama und John F. Kennedy.
Er kann es also schaffen.
Obama kann das Bedürfnis nach Symbolen glaubwürdig bedienen, ja. Die konkrete Politikgestaltung wird vermutlich behindert sein, durch die Republikaner und einige Demokraten, die bei einigen Sachfragen nicht mitmachen werden. Sie haben nach der Rolle des Neoliberalismus in den USA gefragt: Diese Frage wird man beantworten können, wenn ein Präsident Obama sagt, jetzt müssen wir die Finanzmärkte entschlossen regulieren. Dann wird sich zeigen, wie stark die Vertreter der Deregulierung noch sind.
Quelle: ntv.de, Mit Thomas Greven sprach Hubertus Volmer