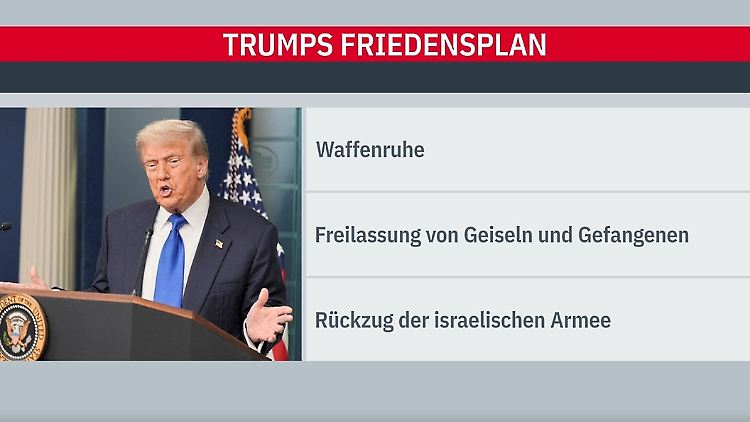Zehn Tote bei Zusammenstößen Wahl in Nigeria löst Unruhen aus
19.04.2011, 07:01 UhrDie Präsidentschaftswahl in Nigeria vertieft offenbar die Spaltung des Landes. Der Sieg des christlichen Amtsinhabers Jonathan über seinen muslimischen Rivalen Buhari wird von Ausschreitungen begleitet. Mindestens zehn Menschen kommen dabei ums Leben. Jonathan versucht, die Lage zu beruhigen.

Bei den Unruhen wurden, wie hier in Kano, auch religiöse Gebäude angezündet.
Nach dem Sieg von Amtsinhaber Goodluck Jonathan bei den Präsidentenwahlen sind in mehreren Städten im überwiegend muslimischen Norden Nigerias Unruhen ausgebrochen. Mindestens zehn Menschen kamen Medienberichten zufolge in den Bundesstaaten Gombe und Bauchi ums Leben. Um die Gewalt einzudämmen, wurde in mehreren Städten eine Ausgangssperre verhängt.
Der in seinem Amt bestätigte Jonathan appellierte an die Bevölkerung, Ruhe zu bewahren: "Politischer Ehrgeiz ist kein Blutvergießen wert", betonte er in einer am Abend veröffentlichten Stellungnahme. "Wir dürfen den Verlust von Leben nicht zulassen." Die Gewalt sei "unnötig und vermeidbar".
Nach Angaben der Unabhängigen Wahlkommission erhielt der erst seit dem vergangenen Jahr amtierende Jonathan knapp 22,5 Millionen Stimmen. Sein größter Herausforderer, der ehemalige Militärmachthaber Muhammadu Buhari, kam auf gut 12,2 Millionen Stimmen. Wie die Kommission weiter mitteilte, hatten fast 34,5 Millionen der mehr als 73 Millionen registrierten Wähler ihre Stimme abgegeben.
Unruhen erreichen Hauptstadt
Bei den Unruhen wurden mehrere Häuser von Funktionären der regierenden Demokratischen Volkspartei (PDP) Jonathans niedergebrannt. Auch aus dem Süden stammende Einwohner wurden angegriffen. "Sie haben unsere Autos und Häuser zerstört. Ich rannte um mein Leben", zitierte die Zeitung "Next" eine aus dem Süden stammende Frau aus der Stadt Zaria.
Nach Angaben des Roten Kreuzes wurden mindestens 276 Menschen verletzt und mindestens 15.000 Menschen in die Flucht getrieben. "Wir haben 276 Menschen versorgt und in Krankenhäuser gebracht", berichtete der Koordinator für Katastrophenmanagement des Roten Kreuzes, Umar Abdul Mairiga. "Wir planen, 15.000 Vertriebenen einen Unterschlupf zu geben." Die Zahlen stammten laut Mairiga aus zehn der 14 von Gewalt betroffenen Bundesstaaten.
Die Unruhen hatten sich bis in die nigerianische Hauptstadt Abuja ausgebreitet. Einwohner versuchten sich in Sicherheit zu bringen, während es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen jugendlichen Anhängern Buharis und der Polizei kam.
Jonathan geht auf Gegner zu
Wahlbeobachter der Afrikanischen Region bezeichneten die Präsidentenwahl im bevölkerungsreichsten Land Afrikas nach umfangreichen Wahlreformen als die korrektesten und ordentlichsten seit Jahrzehnten. Allerdings bewahrheitete sich die Befürchtung vieler Experten, dass die Wahl die ethnischen und religiösen Gräben in dem ölreichen Vielvölkerstaat vertiefen könnte.
Staatschef Jonathan bemühte sich nach der Wahl, die Lage mit versöhnlichen Worten an seine unterlegenen Herausforderer zu entspannen. "Ich gratuliere den Kandidaten der anderen politischen Parteien", erklärte Jonathan. "Ich betrachte sie nicht als Gegner, sondern als Partner." Dabei erwähnte er namentlich auch den 67-jährigen Muslim Muhammadu Buhari.
Wahl stark überwacht
Rund 73 Millionen Nigerianer waren aufgerufen, über ein neues Staatsoberhaupt zu bestimmen. Außer Buhari vom neu gegründeten Kongress für fortschrittlichen Wandel galt Nuhu Ribadu vom Aktionskongress für Nigeria als wichtigster Herausforderer Jonathans.
Beide Parteien hatten bei der Parlamentswahl eine Woche vor den Präsidentenwahlen gute Ergebnisse erreicht und Jonathans PDP wohl um ihre Zwei-Drittel-Mehrheit gebracht. Das Endergebnis liegt noch nicht vor, weil in einem Teil des Landes noch am 26. April nachgewählt werden muss.
Die Wahlen wurden nach politischer Gewalt im Vorfeld von starken Sicherheitsmaßnahmen begleitet. Mehr als 17.000 Polizisten und Soldaten waren im Einsatz. Neben radikalen Islamisten hatten Rebellen im ölreichen Nigerdelta mit Anschlägen gedroht.
Quelle: ntv.de, dpa/AFP