Die Zukunft der Linkspartei "Wir müssen die Flügelitis überwinden"
24.05.2012, 11:48 Uhr
Wohin führt der Weg der Linkspartei?
(Foto: picture alliance / dpa)
Lafontaine ist raus. Doch was bedeutet der Abgang ihrer Symbolfigur für die Zukunft der Linkspartei? Ist es der große Befreiungsschlag oder der Anfang vom Ende? Im Gespräch mit n-tv.de verrät der Berliner Linken-Chef Klaus Lederer, warum die Partei Lafontaine zwar braucht, sein autoritärer Führungsstil die Partei aber in die Krise gebracht hat. Er fordert: "Es muss jetzt wieder ein Klima geben, in dem einander zugehört wird."

Klaus Lederer ist Landesvorsitzender der Linkspartei in Berlin.
(Foto: picture alliance / dpa)
n-tv.de: Katharina Schwabedissen und Katja Kipping wollen gemeinsam für den Parteivorsitz kandidieren. Überrascht Sie das?
Klaus Lederer: Es hat sich angedeutet. Die beiden hatten in den letzten Tagen immer wieder angedeutet, dass es noch einen dritten Weg geben könnte. Dass die beiden ihre Kandidatur erklären, kurz nachdem Lafontaine seinen Rückzug verkündet: Da hab ich in dem Augenblick nicht mitgerechnet.
Sie können sich also vorstellen, dass die beiden die Partei führen?
Entscheidend ist am Ende, dass Leute die Partei führen, die miteinander können. Es kommt darauf an, dass in einem 44-köpfigen Parteivorstand Menschen an einem Tisch sitzen, die das über die Differenzen hinweg gemeinsam und produktiv machen wollen. Entscheiden muss jetzt der Parteitag. Ich bin jedenfalls offen und habe auch keine Lust mehr, dieses Spiel, dass in den vergangenen Wochen reichlich gespielt worden ist, fortzusetzen.
Welches Spiel?
Menschen müssen ihre Kandidatur ankündigen können, ohne direkt einem Lager zugeordnet zu werden. Ist das jetzt Pro-Bartsch oder Pro-Lafontaine? Dietmar Bartsch hat ja auch von vornherein klar gemacht, dass ihm weitere Kandidaturen wichtig sind. Damit haben wir jetzt eine solche Situation, durch die in der Partei auch wieder eine richtige Debatte möglich wird. Ich wünsche mir, dass die Personalangebote auch noch stärker mit inhaltlichen Aussagen unterfüttert werden.
Wofür steht denn Bartsch?
Bei Bartsch ist es klar: Er will sich für die Reorganisation der Partei, für einen offenen demokratischen Prozess und eine pragmatische, aber trotzdem radikale politische Positionierung einsetzen. Ich unterstelle einfach mal, dass das bei Schwabedissen und Kipping auf etwas Ähnliches hinausläuft.
Bartsch gilt eher als Reformer - welcher Strömung sind die beiden Frauen zuzuordnen?

Kandidieren zusammen für den Vorsitz: Schwabedissen (l.) und Kipping.
(Foto: picture alliance / dpa)
Von dem Lagerdenken wollen wir ja eigentlich weg. Katharina Schwabedissen ist mal der Antikapitalistischen Linken zugerechnet worden. Aber bei dem Angebot von Lafontaine hat sie auch gefragt, ob das der richtige Weg sei. Da zeigt sich auch, dass wir mit diesem Schubladendenken nicht mehr weiterkommen. Wir müssen uns jetzt fragen: Wie können wir uns wieder zusammenraufen und diese Flügelitis überwinden?
Sie hatten bereits eine Präferenz für Bartsch ausgesprochen. Bleibt es dabei?
Es war damals die einzige Kandidatur, deswegen habe ich mich dazu bekannt. Ich traue ihm das zu, in einer solchen Situation die Partei zusammenzubringen. Aber ich weiß auch, dass es viele Vorbehalte gegen Bartsch gibt. Das ist auch der Grund, warum jetzt andere den Kopf rausstrecken.
Die letzten beiden Vorsitzenden Klaus Ernst und Gesine Lötzsch waren von Anfang bis Ende umstritten. Was ist, wenn am Ende auch der neue Vorsitzende von einem Teil der Partei wieder deutliche Abneigung zu spüren bekommt?
Das ist das Wichtigste: Wenn es im Vorfeld mehrere Kandidaten gibt, müssen am Ende auch alle Beteiligten mit dem Ergebnis der Wahl vernünftig umgehen und auch miteinander können.
Sie gehörten in den letzten Wochen zu den heftigsten Kritikern von Lafontaine. Sein Vorgehen, nur für den Parteivorsitz zu kandidieren, wenn Dietmar Bartsch es nicht tut, bezeichneten Sie als Erpressungsmanöver. Sind Sie froh über seinen Rückzug?
Ich habe kein Problem mit Oskar Lafontaine. Er hat in der Entwicklung der Partei immer eine wichtige Rolle gespielt. Mir war die Zuspitzung der letzten Wochen nicht recht. Ich hatte etwas gegen dieses Prinzip, dass die Partei zur Geschlossenheit gerufen werden soll, anstatt diese praktisch durch offenen Diskurs herzustellen. In den nächsten Wochen sind die Beteiligten dazu aufgerufen, neue Zuspitzungen zu vermeiden. Alle Kandidaten müssen miteinander in einem fairen Prozess verhandeln, in dem am Ende eine Parteiführung gewählt wird, die eine Chance hat, bis zur Bundestagswahl und darüber hinaus die Partei vorwärts zu bringen.
Lafontaine gilt als bester Wahlkämpfer der Partei. Es ist jetzt kaum vorstellbar, dass er in eine relevante bundespolitische Position zurückkehrt. Wie riskant ist das für die Zukunft der Linkspartei?
Lafontaine ist nach wie vor Fraktionsvorsitzender im Saarland. Er hat die Möglichkeit, im nächsten Jahr auf der Landesliste für den Bundestag zu kandidieren. Würde er das tun, wäre er mit Sicherheit ein hervorragender Kopf. Dann ist er ein medial interessanter Faktor und jemand, der in zugespitzter Weise die Differenzen zu den anderen Parteien deutlich macht. Dagegen spricht nichts. Unsere Partei darf in der Öffentlichkeit nicht länger als zerrissener selbstbeschäftigter Haufen dastehen, sondern als Partei, die sich der Probleme annimmt, die vielen auf den Fingern brennen.
Ist Lafontaines Rückzug für die Partei ein Befreiungsschlag?
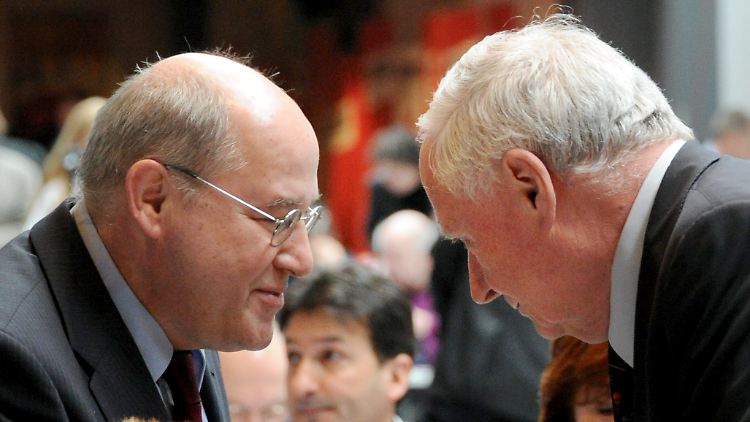
Die Jungen drängen nach vorn. Was wird aus Gysi und Lafontaine?
(Foto: picture alliance / dpa)
Wir haben uns in den letzten fünf Jahren ganz oft Debatten verkniffen, weil wir Angst hatten, dass uns der Laden um die Ohren fliegt. Das hatte auch damit zu tun, dass alle ihre Hoffnung in die ganz starken Personen an der Spitze, in Gysi und Lafontaine gesetzt haben, diese Prozesse zu moderieren. Das ist jetzt an Grenzen gelangt. Es muss wieder ein Klima geben, wo einander zugehört wird. Insofern haben wir jetzt eine Chance und es liegt an uns, sie zu nutzen.
Hängt das zusammen: die zu starke Fokussierung auf Gysi und Lafontaine einerseits und der derzeit so schlechte Zustand der Partei?
Mit Sicherheit hängt das zusammen. Die Situation 2005 und 2007 ist eine andere als heute. Viele Debatten sind nicht geführt worden, auch aus Sorge und Angst, es könnte der Partei schaden. Für mich geht es jetzt zum Beispiel um die Frage: Wie gehen wir um mit einer Situation, in der wir das Parteiensystem mit einer schwachen SPD auf Schröder-Kurs nicht einfach aufgerollt bekommen? Und wie gehen wir damit um, dass unsere Alleinstellungsthemen - Mindestlohn, Erbschaftssteuer, Hartz IV, die Rente mit 67 und Afghanistan - zu korrigieren, zumindest verbal auch von anderen Parteien aufgegriffen worden sind?
Lafontaine hat seinen Rückzug bereits erklärt. Inwiefern hat das auch Signalwirkung für Gysi, den Weg für die neue Generation freizumachen?
Gregor hat es in den letzten Jahren immer abgelehnt, sich an die Parteispitze zu setzen. Als Fraktionsvorsitzender hat er hervorragende Arbeit geleistet. Ich glaube, die Debatte steht überhaupt nicht an. Er ist nach wie vor eine sehr strahlkräftige Persönlichkeit, ein Mensch, den wir brauchen. So wie wir eigentlich auch Lafontaine bräuchten. Trotzdem ist richtig, dass es in unserer Partei viele Jüngere gibt, die Potenzial haben. Es ist wichtig, die Frage aufzuwerfen, welche Rolle sie bei der Entwicklung einer streitbaren Identität unserer Partei spielen. Denn das hat in den letzten Jahren ja nicht so gut und schnell geklappt, wie es viele erhofft haben.
War die Einheit von PDS und WASG in den letzten Tagen gefährdet? Hatten Sie Angst vor einer Spaltung der Partei?
Es gibt sicherlich unterschiedliche Verankerungen und Sozialisierungen und Kulturen. Es war nie ein reines Ost-West-Problem, sondern eine inhaltlich begründete Differenz. Die Frage ist: Will man sich als reine Protestpartei definieren, oder will man die anderen mit einer konstruktiven Botschaft vor sich hertreiben und offen sein? Viele im Osten wissen, dass bei allen Schwierigkeiten, die in den letzten Wochen deutlich zutage getreten sind, eine ostdeutsche Regionalpartei keine Option sein kann.
Sie gehören einem Landesverband an, der bereits an einer Regierungskoalition beteiligt war. Ist die Bereitschaft für eine Regierungsbeteiligung auch der Kurs, der für die Bundes-Linke eine größere Rolle spielen sollte?
Über politische Bündniskoalitionen auf Zeit muss man reden. Ich finde, das ist kein Selbstzweck. Es ist kein politisches Ziel, aber eine Möglichkeit neben solider Oppositionsarbeit. Kompromisse auszuhandeln, das ist ein Lernprozess. Da macht man Fehler. Wir haben das in Berlin erlebt. Die spannendste Erkenntnis, auch aus den Wahlergebnissen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, ist: Keines der Erfolgsrezepte der Vergangenheit lässt sich einfach eins zu eins in die Zukunft projizieren. Keine der Optionen, ob alles auf Regieren oder doch auf Opponieren zu setzen, sind an sich Erfolgsrezepte. Die Tatsache, dass wir beide Erfahrungen erlebt haben, ist ein spannender Anknüpfungsprozess für eine Zukunftsdebatte.
Mit Klaus Lederer sprach Christian Rothenberg
Quelle: ntv.de









