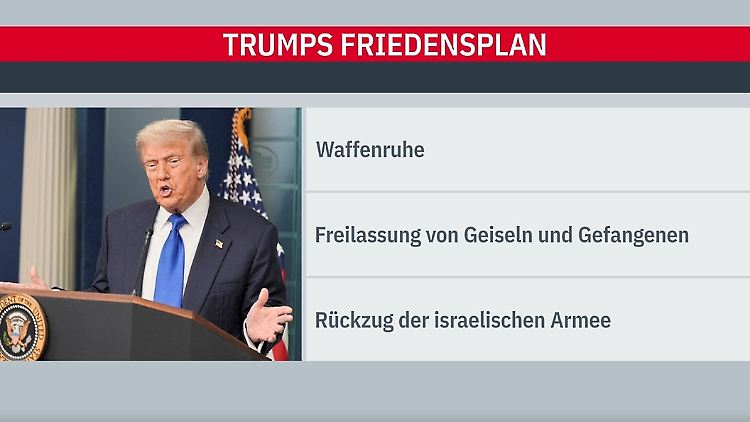"... die Tür aufmachen" DDR-Demo vor 20 Jahren
16.01.2008, 10:41 UhrDas kleine, selbstgemalte Plakat war nur wenige Sekunden zu sehen. DDR-Sicherheitskräfte unterbanden am 17. Januar 1988 in Ost-Berlin schnell die "Provokation" von couragierten Oppositionellen. Sie hatten ein Transparent mit dem Text "Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden" hochgehalten - in Anlehnung an ein Zitat Rosa Luxemburgs. Damit wollten sie für Meinungsfreiheit auf die Straße gehen. Doch der Protest wurde im Keim erstickt - Festnahmen und Ausweisungen von DDR-Bürgerrechtlern folgten. Sie hatten mit ihrer Aktion vor 20 Jahren am Rande der traditionellen DDR-Demonstration zum Gedenken an die ermordeten Arbeiterführer Luxemburg und Liebknecht ein Signal mit Folgen gesetzt.
"Die Vorbereitung einer eigenen Kundgebung war bei meiner Verhaftung eine Woche später nur das Tüpfelchen auf dem I", erinnert sich Wolfgang Templin, damals Mitglied der Initiative für Frieden und Menschenrechte. Am Tag der Demonstration sei er, anders als einige unbekanntere Mitstreiter, wegen Hausarrests aber nicht mal aus der Wohnung gekommen, sagt der Publizist der Deutschen Presse-Agentur dpa. "Wir wollten die Tür aufmachen, den Schritt nach außen wagen", umreißt er die damaligen Aktivitäten verschiedener Menschenrechts-, Friedens- und Kirchengruppen. Die Verhaftungswelle nach der Demonstration habe auch Bärbel Bohley, Ralf Hirsch, Freya Klier, Werner Fischer und Vera Wollenberger (heute Lengsfeld) getroffen.
Tragische Schicksale
Er sei dann gezwungen worden, am 2. Februar 1988 zu einem "Studienaufenthalt in die Bundesrepublik" auszureisen, nachdem ihm "landesverräterische Agententätigkeit" vorgeworfen worden war, erinnert sich der gelernte Philosoph. Nach Angaben des Berliner Bürgerbüros waren im Umfeld der Demonstration vor 20 Jahren rund 160 Kritiker des DDR-Regimes "festgesetzt worden". Für ihn sei aber im Gegensatz zu anderen Bürgerrechtlern eine Reform der DDR kein Ziel mehr gewesen, sagt Templin.
Die Bürgerrechtler seien isoliert gewesen und hätten die breite DDR-Bevölkerung erst anderthalb Jahre später im Herbst 1989 erreicht, sagt der Berliner Politikwissenschaftler Klaus Schroeder. Der Politikprofessor sieht das Schicksal einiger Akteure von einst als tragisch an. Sie hätten den Mauerfall mit angestoßen, seien aber nun von der politischen Bühne "abgeräumt".
Templin hat eine andere Sicht: Er habe nicht das Gefühl, auf dem historischen Erbe sitzenzubleiben, sondern könne vielmehr seine Erfahrungen gerade mit Blick auf Osteuropa einbringen. Doch der heute 59-Jährige sieht auch, dass ein Teil der mutigen Akteure heute tief enttäuscht ist und sich zurückgezogen hat.
Regisseurin Freya Klier schätzte kürzlich in einem Interview ein, dass die DDR-Widerständler 1990 "nur schwer aus dem Startloch kamen". Es sei zu schnell gegangen mit der Einheit. Templin erklärt es so: "Die Chancen und Herausforderungen von 1989 sind von einem Teil der Gesellschaft - auch der westdeutschen - nicht wahrgenommen worden." Auch daraus resultiere Verbitterung. Hinzu komme, dass alte DDR- Eliten und Stasi-Leute längst wieder öffentliche Auftritte zelebrierten und ihre Tätigkeit rechtfertigten.
Auseinandersetzung mir der Vergangenheit gefordert
Klier und Templin fordern auch deshalb eine andauernde Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Wie schwer das ist, bewies kürzlich eine Schülerstudie. Sie zeigte, dass viele Gymnasiasten die Stasi für einen "ganz normalen Geheimdienst" hielten und nicht wussten, wer die Mauer gebaut hat.
Noch viel weniger dürften sie die Namen von Bürgerrechtlern kennen. Sie sind zersplittert. Spätestens im September 1995 war der ganz tiefe Riss durch die ehemaligen Widerständler gegangen. Nach einem medienwirksamen Treffen der Symbolfigur der DDR-Opposition Bärbel Bohley mit dem damaligen CDU-Kanzler Helmut Kohl in ihrem Berliner Atelier zerschnitten rund 60 ehemalige Mitstreiter das Tischtuch. "Wir distanzieren uns von Leuten, die diesem Kanzler im Tausch gegen ein paar vage Versprechungen die Legitimation der DDR-Bürgerbewegung verschaffen wollen", erklärten die Enttäuschten.
Vielleicht hat das Zerwürfnis auch dazu beigetragen, dass Bohley Deutschland den Rücken kehrte. Sie lebe seit Jahren in Kroatien und betreibe Projekte, heißt es im Bürgerbüro. Der Verein kümmert sich um die Aufarbeitung von Folgeschäden der SED-Diktatur.
Von Jutta Schütz und Ulrike von Leszczynski, dpa
Quelle: ntv.de