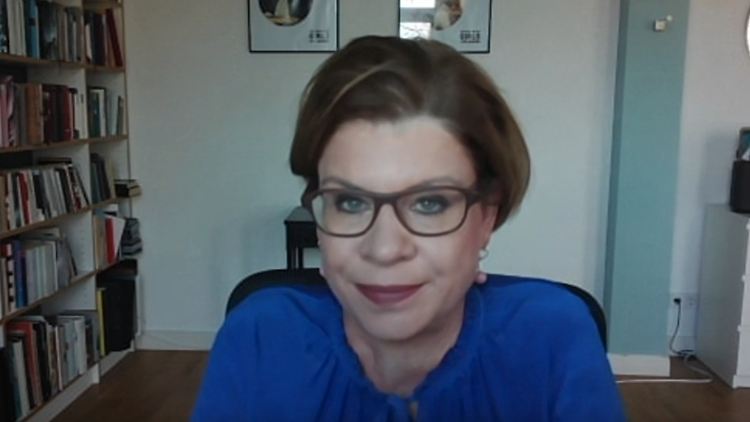Nachtwei und Gertz zu Afghanistan "Da kommt mir die Suppe hoch"
19.09.2008, 05:00 UhrDer eine kommt aus der Friedensbewegung, der andere aus der Bundeswehr. Wer jedoch Streit erwartet zwischen dem Chef des Bundeswehrverbands und dem Sicherheitsexperten der Grünen wird enttäuscht: Beim Thema Afghanistan sind Bernhard Gertz, der Vorsitzende des Bundeswehrverbands, und der Grünen-Verteidigungspolitiker Winfried Nachtwei einer Meinung: Die Bundesregierung hat versagt.
n-tv.de: Herr Gertz, Herr Nachtwei - Sie fordern beide, Deutschland solle sich in Afghanistan auf den Wiederaufbau konzentrieren. Ist ein militärischer Sieg über die Taliban nicht aber die Voraussetzung für einen erfolgreichen Wiederaufbau?
Winfried Nachtwei: Ein militärischer Sieg über die Taliban ist aussichtslos. In Teilen der ISAF herrscht die Vorstellung, man könne zunächst die Taliban besiegen und sich dann in den "gesäuberten" Regionen um den Wiederaufbau kümmern. Nach allen bisherigen Erfahrungen in Afghanistan ist das ein Vorgehen, bei dem es insgesamt eher schlimmer wird.
Bernhard Gertz: Dem kann ich nur zustimmen. Ein militärischer Sieg gegen die Taliban ist unter den herrschenden Bedingungen nicht möglich. Dazu gehört die definitiv nicht kontrollierbare Grenze mitten durch das Paschtunen-Gebiet zwischen Afghanistan und Pakistan; und dazu gehört die fehlende Fähigkeit und Bereitschaft der pakistanischen Machthaber, die Rückzugsgebiete, Nachschubbasen, Rekrutierungszentren und Trainingscamps der Taliban in Pakistan unter Kontrolle zu bringen. Dort gibt es etwa 7000 Koranschulen, in denen die Taliban jeden Tag neue Kämpfer rekrutieren können. Die Vorstellung, man müsse nur noch mehr Militär einsetzen, um noch mehr Gegner zu töten, und werde dann siegen, hat sich schon in anderen von Amerika geführten Kriegen als falsch erwiesen. Ich frage mich manchmal, warum die Erinnerung bei unseren amerikanischen Freunden an die Schwierigkeiten in solchen Auseinandersetzungen asymmetrischer Art nicht stärker ist.
Was ist die Alternative?
Gertz: Für Afghanistan gibt es nur eine Lösung: den Wiederaufbau nicht länger so halbherzig zu betreiben, wie die Staatengemeinschaft es bisher gemacht hat, sondern wesentlich mehr Engagement aufzubringen - mehr Manpower, mehr Ressourcen, mehr Konsequenz, mehr Kontinuität. Dann wäre auch das Missverhältnis zwischen den Kosten der militärischen Präsenz und dem eigentlichen Ziel, dem zivilen Wiederaufbau, in Ordnung gebracht. Die militärische Präsenz soll ja nur einen Rahmen für den Wiederaufbau bieten.
Aber wie kann man Wiederaufbau leisten, wenn gleichzeitig Krieg stattfindet?
Nachtwei: In der schwierigen Unruheprovinz Urusgan legen die Niederländer seit zwei Jahren die Priorität auf den Wiederaufbau. Sie gucken, wo es Bedarf bei der Bevölkerung gibt, wo Kooperationsmöglichkeiten liegen, und da setzen sie an. Sie wollen die Taliban indirekt zurückdrängen, indem die vielen anderen Afghanen für den gemeinsamen Aufbau gewonnen werden. Das ist nicht mit Schwäche zu verwechseln: Wenn die Niederländer attackiert werden, antworten sie sehr massiv. In den Bergen von Urusgan gehen die amerikanischen Truppen aber genau umgekehrt vor: Sie wollen die Taliban erst militärisch zurückdrängen und sich dann um den Wiederaufbau kümmern. Das aber führt zwangsläufig zu immer mehr zivilen Opfern.
Gertz: Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, dass man mit konkreten Aufbaumaßnahmen die Lebensverhältnisse der Menschen verbessert; dass man ihnen ein Motiv gibt, die jetzige Regierungsform der Herrschaft der Taliban vorzuziehen. Insbesondere unsere Verbündeten aus den USA, aus Kanada und aus Großbritannien sind leider der Meinung, man müsse die Regionen vor dem Wiederaufbau militärisch "säubern", sie "clean" machen. Beim Säubern bringt man allerdings so viele unbeteiligte Zivilisten um, dass man die Stimmung dramatisch vergiftet.
Nachtwei: In Afghanistan gibt es eine Gleichzeitigkeit von Anschlägen und Aufbau, die von Deutschland aus nicht ganz leicht nachzuvollziehen ist. Nach dem Sprengstoffanschlag in Kundus, bei dem ein Bundeswehrsoldat getötet wurde, habe ich dort bei unseren Entwicklungshelfern angerufen. In Deutschland herrschte der Eindruck vor, die Helfer vor Ort könnten gar nicht mehr arbeiten. Die haben aber gesagt, sie müssten wohl hier und da stärker aufpassen, könnten aber durchaus weiter arbeiten.
Gertz: Je näher man an den Menschen dran ist, desto mehr Informationen bekommt man. Und desto eher wird man auch gewarnt, falls sich irgendwo etwas ereignet, was die eigene Sicherheit möglicherweise gefährden könnte.
Verteidigungsminister Jung hat bereits vor zwei Jahren gesagt, das Konzept müsse lauten: "Sicherheit und Wiederaufbau". Viel passiert ist nicht.
Gertz: Die Bundesregierung hat eigentlich immer das Richtige gesagt. Nur hat sie es nicht umgesetzt. Vor allem hat sie es versäumt, für diese Strategie im Rahmen der NATO zu werben. Wann immer gefordert wurde, die Deutschen müssten auch in den Süden gehen, wurde viel zu defensiv reagiert ...
Nachtwei: ... nach dem Motto: In meinem nördlichen Kleingarten mache ich, was ich für richtig halte, ansonsten schaue ich lieber nicht so genau hin. Das ist ein großer Fehler.
Gertz: Die Bundesregierung hätte sagen müssen: Wir haben die richtige Strategie, die muss in ganz Afghanistan angewandt werden, soweit das möglich ist. Wir gehen deshalb nicht in den Süden, weil wir nicht an einem "War on Terror" teilnehmen wollen, wie ihn unsere Verbündeten dort führen. Solange das so bleibt, werde ich jedes Mal warnend den Finger heben, falls irgendeiner meint, die Deutschen müssen die gleichen Lasten tragen wie die anderen.
Im Oktober steht die Verlängerung des Afghanistan-Mandats im Bundestag an. Wird das Mandat den Herausforderungen gerecht?
Nachtwei: Ich befürchte nein. Wahrscheinlich wird dieses Mandat nur die Fortsetzung der bisherigen militärischen Beteiligung beinhalten, was durchaus richtig ist. Zum Zweiten wird die Aufstockung der Obergrenze auf 4500 Soldaten beschlossen, was militärisch plausibel ist; drittens möglicherweise auch noch der AWACS-Einsatz, über den man streiten kann. Das alles ist aber ganz und gar nicht ausreichend. Meine dringende Empfehlung ist, das Mandat jetzt umfassend neu zu formulieren. Energieversorgung, Wasserinfrastruktur, Bildungswesen, Polizei - die Schlüsselbereiche des Aufbaus müssen ins Zentrum des Mandats geschrieben werden. Und dafür müssen wir dann ehrgeizige, aber erreichbare Ziele definieren. Wir haben nicht endlos Zeit. Die Stimmung sinkt, die Enttäuschung der Bevölkerung gegenüber der eigenen Regierung ist maßlos, die Enttäuschung gegenüber der internationalen Gemeinschaft ist erheblich. Das kriegt man nur noch mit einer neuen Anstrengung rumgerissen. Im Afghanistan-Konzept der Bundesregierung ist davon leider nichts zu sehen.
Gertz: Das Mandat muss deutlich machen, dass es um mehr geht als den Einsatz der Bundeswehr. Dann würde vielleicht auch der eine oder andere in der Bundesregierung erkennen, dass der Mittelaufwand für das Kerngeschäft verglichen mit dem Mittelaufwand für den militärischen Rahmen in einem ausgesprochenen Missverhältnis steht. Mindestens vier Bundesministerien sind beteiligt: das Außenministerium, das Innenministerium, das Entwicklungshilfeministerium und das Verteidigungsministerium. Doch wird die Debatte in Deutschland auf den militärischen Einsatz reduziert, die Polizeiarbeit etwa kommt dabei viel zu kurz. Ein Anzeichen dafür: Der zuständige Innenminister Wolfgang Schäuble war bislang nicht ein einziges Mal in Kabul.
Sie meinen, die Bundesregierung setzt die falschen Prioritäten?
Nachtwei: Es ist leider noch schlimmer. Von der Komplexität, von den Kosten und von den blutigen Risiken her ist Afghanistan die größte Herausforderung, die es je für die bundesdeutsche Außenpolitik gab. Das hat die Bundesregierung noch immer nicht erkannt.
Hat Ihr grüner Ex-Außenminister Joschka Fischer es nicht auch versäumt, die Weichen in die richtige Richtung zu stellen?
Nachtwei: Konzeptionell waren die Weichen im Petersberg-Prozess richtig gestellt: Die Förderung der Zivilgesellschaft, die Einbeziehung von Stammesstrukturen - das ist alles von Deutschland initiiert worden. Aber wir haben die Dimension der Herausforderung enorm unterschätzt. Zum Beispiel beim Aufbau der afghanischen Polizei: Die deutschen Polizisten leisten dort gute Arbeit. Aber wenn wir erst 12 hinschicken, am Ende 40, ist das angesichts der Verhältnisse - der offenen Grenzen, der Drogenkriminalität, des maßlos schlechten Ansehens der Polizei - nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Gertz: Zumal, ich übertreibe jetzt nur ganz leicht, jeweils 37 Polizisten in Kabul waren, nur einer in Kundus, einer in Faisabad und einer in Masar-i-Scharif. Afghanistan ist sieben Mal so groß wie Deutschland. Da muss die Polizei in der Fläche präsent sein, wenn die Zentralregierung irgendeine Form von Staatsgewalt ausüben will. Und die afghanischen Polizisten müssen auch regelmäßig und vollständig bezahlt werden, damit sie sich nicht nach der Ausbildung beim nächstbesten Drogenbaron für ein besseres Gehalt verdingen.
Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Konrad Freiberg, sagt, statt weiterer Polizei-Aufbauhilfe würden in Afghanistan "paramilitärische Einheiten" gebraucht.
Gertz: Bei aller Freundschaft zu Konrad Freiberg - zu sagen, der Einsatz in Afghanistan sei mehr eine militärische als eine Polizeiangelegenheit, ist objektiv falsch. Natürlich muss man afghanischen Polizisten auch beibringen, wie man einen Kontrollpunkt errichtet. Da haben Soldaten das nötige Know-how. Aber im Wesentlichen geht es um Polizeiaufbau. Als ich vor ein paar Tagen wieder einmal gemeckert habe, habe ich aus dem Innenministerium den Spruch gehört, unter deutscher Leitung seien in Afghanistan 22.000 Polizisten ausgebildet worden.
Nachtwei: Niemand weiß, wo die gelandet sind.
Gertz: Ich halte das für eine dreiste Lüge. Und das ist noch sehr freundlich formuliert. Vielleicht haben sie alle Polizisten zusammengezählt, die unsere amerikanischen Freunde und andere Staaten ausgebildet haben. Nur: Wie viele Polizisten sind davon übrig geblieben? Beim Aufbau der afghanischen Armee wurde im August 2007 Bilanz gezogen; bis dahin waren 57.000 Soldaten der Afghan National Army ausgebildet worden. Es waren aber nur noch 17.000 da, 40.000, mehr als zwei Drittel, waren weg. Seitdem hat man in diesem Bereich sehr viel stärker zielgerichtet investiert und man rüstet sie ordentlich aus. Bei der Polizei war das Verhältnis sogar noch schlechter. Wenn ich dann vom Innenministerium höre und auch im Afghanistan-Konzept der Bundesregierung lese, wie man das deutsche und internationale Versagen in diesem Bereich schön schreibt, dann kommt mir die Suppe hoch.
Jung hat gesagt, wenn die Zahl von 80.000 Soldaten und 82.500 afghanischen Polizisten erreicht sei, "können wir darüber nachdenken, wann unser Auftrag erfüllt ist".
Gertz: Da hat er wohl Recht. Aber wenn er das ernst nimmt, dann hätte man in diesem Punkt schon viel weiter sein müssen und viel mehr investieren müssen. Denn eine selbsttragende Sicherheitsstruktur ohne eine in der Fläche präsente und loyale und möglichst nicht korrupte Polizei gibt es nicht. Das gleiche gilt für die Streitkräfte. Das sage ich auch selbstkritisch. Es hat bis 2007 gedauert, bis der deutsche Generalinspekteur Wolfgang Schneiderhan seine Kollegen aus den Ländern, die im Norden Afghanistans Truppen stellen, versammelt hat, um mit denen zu besprechen, welche Ziele bei der Ausbildung der Afghan National Army erreicht werden sollen. Bis dahin hat man locker vor sich hin ausgebildet, ohne sich zu verabreden, wann denn die Ausbildung soweit gediehen ist, dass man diese Truppen als einsatzreif bezeichnen kann. Da ich immer so gern auf der Polizeiausbildung rumhacke, will ich diesen Aspekt hier nicht unterschlagen.
Stichwort Abzug: Sehen Sie ein Worst-Case-Szenario, das einen Abzug der Bundeswehr in Afghanistan rechtfertigen würde?
Gertz: Das ist ein Punkt, über den ich nicht gern spreche. Ich will mir nicht vorstellen, dass wir alles verraten, was wir bislang in den Aufbau des Landes investiert haben, dass wir auch die Menschen verraten, die dabei gefallen sind oder verwundet wurden. Wir müssen den Weg konsequent zu Ende gehen. Ein Abzug würde bedeuten, dass wir das Land den Taliban überlassen. Das würde die Stabilität der ganzen Region weiter unterhöhlen. Und wenn die Taliban in Afghanistan wieder an die Macht kommen, dann gnade uns Gott. Wir wollten schließlich verhindern, dass international operierende Terroristen in Afghanistan staatlichen Schutz und staatliche Deckung finden. Wir sind zum Erfolg verurteilt.
Nachtwei: Ein kurzfristiger Abzug würde eine rasende Radikalisierung der Gewalt zur Folge haben. Diese Einschätzung teilen auch alle Leute aus der Zivilgesellschaft vor Ort. Ein Punkt könnte aber erreicht sein - er darf zwar nicht erreicht werden, aber so etwas ist nicht auszuschließen -, wenn sich auch im Norden eine Aufstandsbewegung entwickeln würde, die von der Bevölkerung getragen wird. Das wäre eine Verschlimmerung unter relativ günstigen politischen Voraussetzungen. Das wäre das Scheitern.
Gertz: Ja. Dann müssten wir sagen, unser Konzept funktioniert nicht.
Und im Erfolgsfall: Wann kann die Bundeswehr das Land verlassen?
Nachtwei: Dass es so einigermaßen zu einer selbsttragenden Sicherheit kommt, muss in einem überschaubareren Zeitraum möglich sein. Ich glaube, dass die Afghanen ein militärisches Engagement der internationalen Truppen von der jetzigen Intensität über zehn weitere Jahre hinweg nicht aushalten würden. Unsere Gesellschaften übrigens auch nicht.
Welche Hoffnungen oder Befürchtungen haben Sie für die Zeit nach der Präsidentschaftswahl in den USA?
Gertz: Die Amerikaner glauben, dass im Irak eine relative Stabilisierung eingetreten ist, weil sie mehr Truppen ins Land gebracht haben. Das wollen sie jetzt auch in Afghanistan. Tatsächlich hängen die Veränderungen im Irak aber wohl nur teilweise mit den zusätzlichen Truppen zusammen, stärker mit Veränderungen innerhalb der irakischen Gesellschaft. Man kann so viele Taliban ins Jenseits befördern wie man will, es werden immer wieder neue da sein. Das müssen wir den Amerikanern begreiflich machen.
Nachtwei: Afghanistan ist maßlos vernachlässigt worden. Seit zwei Jahren haben die USA aber ihr Engagement in den verschiedenen Bereichen äußerst intensiviert - bei der Polizeiarbeit machen sie uns mittlerweile was vor, da wird auch absolut planmäßig vorgegangen. Ich hoffe, dass ein neuer Präsident, Obama vielleicht noch stärker als McCain, in der Lage sein wird, mit den Verbündeten wieder einen Dialog zu führen. Das könnte eine Chance sein; auch wir können von den Amerikanern viel lernen.
Gertz (nickt): Was Afghanistan angeht, gibt es in keinem anderen Land so viel Expertise wie in den Vereinigten Staaten; sie wird nur nicht genutzt, weil die Rumsfelds, die Cheneys, die Wolfowitz' und die Pearls sich nie dafür interessiert haben. Vielleicht würde eine neue Administration diese Ressourcen besser ausschöpfen.
Könnte die Bundesregierung dann auch mit ihrer strategischen Position durchdringen?
Gertz: Deutschland wird nur ernst genommen, wenn wir beim Wiederaufbau klotzen statt zu kleckern. Das ist der entscheidende Punkt.
Mit Winfried Nachtwei und Bernhard Gertz sprachen Till Schwarze und Hubertus Volmer
Quelle: ntv.de