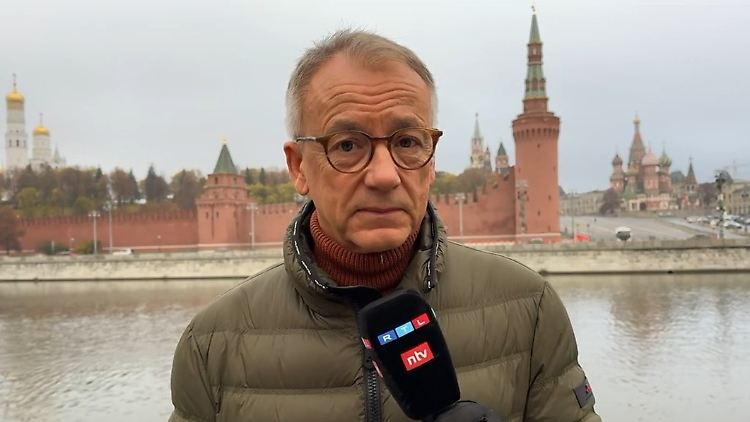1938 kippte die Stimmung Hakenkreuze in Buenos Aires
10.04.2008, 00:00 UhrMit dem Volkszorn der Argentinier haben sie nicht gerechnet. 20.000 Deutsche und Österreicher feiern am 10. April 1938 im Luna-Park von Buenos Aires in Lederhosen, Trachten und mit Hitler-Gruß den "Anschluss" der Alpenrepublik an das Deutsche Reich. Draußen verbrennen unterdessen Argentinier Hakenkreuzfahnen. Fensterscheiben deutscher Geschäfte gehen zu Bruch, bei den Protesten gibt es Tote. Die Deutsche La Plata Zeitung geißelt die Krawalle als "systematische Hetze gegen eine befreundete Nation". Von diesem Tag an wird die Lage für die 250.000 Deutschen und Deutschstämmigen im Land unbequem. Vielerorts schlägt die Stimmung in Feindschaft um, es wird vor einer Unterwanderung Argentiniens durch die Nazis gewarnt.
"Die Argentinier bekamen es mit der Angst zu tun", sagt der Historiker Holger M. Meding von der Universität Köln. Tausende NS-Anhänger, die sich zu einem Aufmarsch zusammenfanden und dem Führer einer europäischen Großmacht huldigten - dies habe bedrohlich auf die Einwanderernation Argentinien gewirkt. "Veranstaltungen dieser Größenordnung auf fremdem Boden bleiben damals wie heute nicht ohne Widerhall, betont der Wissenschaftler. "So hat auch die kürzliche Veranstaltung von 20.000 Türken in Köln in politischen Kreisen der Bundesrepublik nicht unbeträchtliche Irritationen ausgelöst."
Deutsche Parallelgesellschaft
In Argentinien hatte sich seit 1933 ein NS-Biotop jenseits des Atlantiks entwickelt, eine Parallelgesellschaft mit eigener Presse, Schulen, einem Theater und Krankenhaus, Vereinen und Institutionen. 175 Schulen wurden nach 1933 gleichgeschaltet, es gab die Hitler-Jugend und den Bund Deutscher Mädel, vor deutschen Geschäften wehte das Hakenkreuz und NSDAP-Anhänger marschierten zu besonderen Anlässen durch die Straßen von Buenos Aires. "Während die argentinische Regierung besonnen reagierte und den politischen Aktivitäten ausländischer Gruppierungen bald enge Grenzen setzte, herrschte in weiten Teilen der Bevölkerung große Verunsicherung vor", sagt Meding.
Das Argentinische Tageblatt, eine von Schweizer Einwanderern gegründete und gegen die Nationalsozialisten agierende Zeitung, stellte nach den Protesten gegen die "Anschluss-Feier" fest, "dass die argentinische Bevölkerung vom Nazigeist nichts wissen will." In der Forschung wird die Feier vor 70 Jahren, bei der laut Deutscher La Plata Zeitung nur "die Verbundenheit mit den Geschehnissen in der Heimat" ausgedrückt werden sollte, als Wendepunkt gesehen. Bis dahin waren die deutschen Aktivitäten kaum zur Kenntnis genommen wurden.
"Die Regierung musste handeln, wollte sie nicht die Kontrolle verlieren", sagt Meding, der gerade ein Buch zum Thema Argentinien und Nationalsozialismus herausgibt. Allerdings gab es dabei eine Diskrepanz: Teile der Oberschicht und der Regierung hegten Sympathien für das Hitler-Regime. Als aber die Rufe der Öffentlichkeit nach hartem Durchgreifen immer lauter wurden, verbot Präsident Ortiz am 27. April 1938 zumindest das Hissen fremder Flaggen. Und im Mai wurde ein Dekret erlassen, dass die Kultur und Geschichte Argentiniens in den Schulplänen mehr Gewicht zu bekommen hätte.
Nur noch ein "versteckter Hitler-Gruß"
Die deutschen Botschafter Argentiniens, Chiles und Brasiliens kamen zu einer Krisensitzung zusammen - man fürchtete das Aus für jegliche Betätigung. Das vom Chef der NSDAP-Auslandsorganisation geforderte "Gebot des Kurztretens" wurde in die Praxis umgesetzt. Das Argentinische Tageblatt bemerkte erfreut an, dass nun mehr spanisch an deutschen Schulen gelernt wurde. "Und das Horst-Wessel-Lied wird nur noch gesummt und der Hitler-Gruß lediglich versteckt gezeigt."
Nach weiteren Zwischenfällen - unter anderem gab es Gerüchte, Hitler wolle Patagonien erobern - wurde die NSDAP im Mai 1939 in Argentinien verboten. "Vor allem die USA schürten über ihre Geheimdienste und verdeckte Operationen die Bedrohungsängste, um Deutschland zu diskreditieren", sagt Meding. Dennoch blieben die Kontakte der Regierung zum Deutschen Reich auch aus Handelsinteressen eng. Argentinien erklärte dem Deutschen Reich - auf massiven Druck der USA - erst als letzter Staat der Welt im März 1945 den Krieg.
Von Georg Ismar, dpa
Quelle: ntv.de