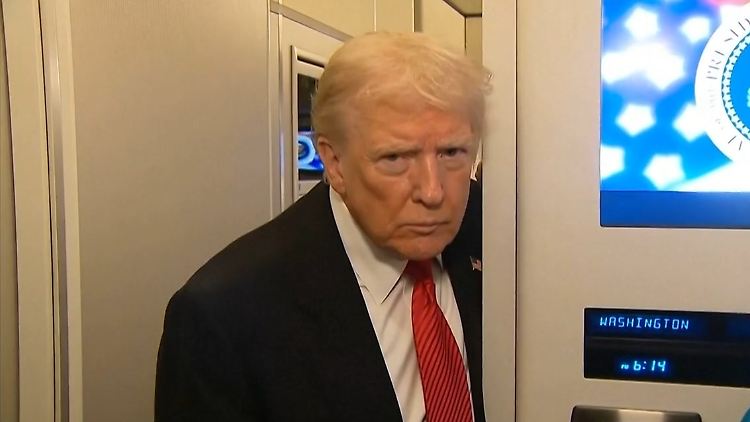Todesstrafe UN ringt um Abschaffung
12.11.2007, 09:02 UhrZwanzig Jahre lang wartete Edward Edmary Mpagi täglich auf seinen Henker, eine zermürbende Minute nach der anderen. Denn in Uganda bekommt ein zum Tode Verurteilter nicht gesagt, wann seine Hinrichtung droht. Jeder Schritt eines Wärters konnte ein Alarmsignal sein. Nach all den grausamen Jahren öffnete sich für Mpagi die Zellentür: Der Mann, den er angeblich ermordet hatte, war irgendwo wieder lebend aufgetaucht. "Tag für Tag in dem Wissen zu leben, dass du jeden Augenblick in den Tod geschickt werden kannst, ist Folter", sagt auch der inzwischen 81 Jahre alte Japaner Sakae Menda, der 34 Jahre lang unschuldig im Gefängnis saß.
Fällen wie diesen wollen die Vereinten Nationen endgültig einen Riegel vorschieben. Am 14. November entscheidet der UN-Menschenrechtsausschuss in New York über eine Resolution, die zumindest alle bereits gefällten Todesurteile aussetzen soll. "Unser Ziel bleibt natürlich, die Todesstrafe ganz abzuschaffen", sagt Mario Marazziti von der italienischen Gemeinschaft Sant'Egidio, die zusammen mit der Menschenrechtsorganisation Amnesty International (AI) fünf Millionen Unterschriften für das Anliegen gesammelt hat.
"Unheimlich mühseliges Verfahren"
Die Resolution, von Italien angeschoben, von Gabun eingebracht und von Deutschland sowie allen anderen EU-Ländern unterstützt, hat inzwischen 83 Befürworter. Aber das reicht noch nicht aus. In der entscheidenden Ausschusssitzung, aber auch bei der Absegnung durch die Vollversammlung im Dezember muss das Papier bei den 192 Mitgliedsstaaten eine Mehrheit finden - also mindestens 97 Stimmen. "Das wird noch ein unheimlich mühseliges Verfahren", sagt ein Kenner der diplomatischen Gepflogenheiten im UN-Hauptquartier.
In 131 Ländern der Welt ist die Todesstrafe nach einer AI-Statistik rechtlich abgeschafft oder wird zumindest in der Praxis nicht mehr vollzogen. 66 Staaten allerdings halten nach wie vor an dem umstrittenen Instrument fest. 90 Prozent aller Exekutionen im vergangenen Jahr wurden in 6 dieser 66 Länder vollzogen: China, Iran, Irak, Pakistan, Sudan und den USA. Europa ist mit Ausnahme von Weißrussland praktisch eine todesstrafenfreie Zone.
Die Befürworter der Resolution verweisen darauf, dass die Todesstrafe Studien zufolge keine abschreckende Wirkung hat. Sie sei grausam, verletze das Menschenrecht auf Leben und könne unumkehrbar auch unschuldige Opfer treffen. "Eine Hinrichtung entwürdigt alle Beteiligten und entwertet menschliches Leben", sagt Amnesty International. "Eine Exekution kann nicht benutzt werden, um Mord zu bestrafen - sie ist Mord."
China, Gastgeber der Olympischen Spiele 2008, hält nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Hands Off Cain mit mindestens 5000 Hinrichtungen im Jahr 2006 den traurigen Rekord. Human Rights Watch sprach kürzlich sogar von 7500 Fällen. Inzwischen hat der Oberste Gerichtshof in Peking eine Direktive erlassen, nach der Exekutionen nur "in äußerst begrenzter Zahl" vollzogen werden sollen.
Immer wieder Fehlurteile
In den Vereinigten Staaten, wo es seit der Wiedereinführung der Todesstrafe 1976 insgesamt 1099 Hinrichtungen gab, liegt das umstrittene Instrument derzeit mehr oder weniger auf Eis. Nach aufsehenerregenden Berichten über "verpfuschte Hinrichtungen" will der Oberste Gerichtshof im kommenden Jahr über die Zulässigkeit der Giftspritze entscheiden. Erschreckend genug: Selbst im angeblichen Musterland der Demokratie kommt es immer wieder zu Fehlurteilen. Seit 1973 wurden US-weit 124 Todeskandidaten nachträglich freigesprochen, weil sich - oft erst nach Jahren - ihre Unschuld herausstellte.
Ray Krone (50) gehört zu diesen Menschen. Gemeinsam mit Mpagi aus Uganda und Sakae Menda aus Japan warb er kürzlich bei den Vereinten Nationen um Zustimmung zur Resolution. "Was mir passiert ist, kann jedem passieren. Das darf nicht sein", sagte er bei einer Anhörung. Krone war 1992 in einem Indizienprozess für den brutalen Mord an einer Bardame zum Tode verurteilt worden. Angeblich passten seine schiefstehenden Zähne zu den Bisswunden am Körper der Toten. Krone ging als "Hasenzahn-Killer" durch die Presse. Zehn Jahre später belegte eine DNA-Probe seine Unschuld.
Von Nada Weigelt, dpa
Quelle: ntv.de