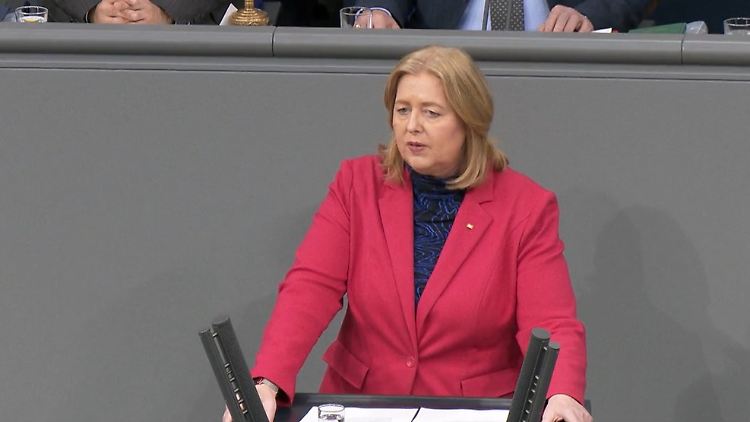Kandidatenkür in den USA Warten auf den Heilsbringer
07.06.2007, 10:44 UhrVon n-tv Korrespondent Christian Wilp, Washington
Wer gehofft hatte, nach den jüngsten Fernsehdebatten der Präsidentschaftskandidaten etwas klarer zu sehen, wird enttäuscht. Sowohl bei den Demokraten als auch bei den Republikanern vermögen die Kandidaten nicht so recht zu überzeugen, allgemeine Ernüchterung macht sich breit.
Zur besten Sendezeit hatte CNN nach Manchester, New Hamphire, eingeladen. In den Staat also, in dem Anfang 2008 traditionell die ersten Vorwahlen zur Auslese der Präsidentschaftskandidaten durchgeführt werden. Bei den Demokraten treten neben sogenannten Berufskandidaten wie dem völlig aussichtslosen Abgeordneten Dennis Kucinich vor allem drei namhafte Bewerber an: Allen voran Hillary Clinton, die aufgrund ihrer prallgefüllten Wahlkampfkasse und günstiger Umfragen das Feld als Top-Favoritin anführt. Daneben der Senkrechtstarter und Nachwuchssenator Barack Obama sowie John Edwards, erfolgloser Vizepräsidentschaftskandidat des Jahres 2004. Und mit diesem Trio beginnen die Probleme.
Hillary gilt als ausgekochter Politprofi, aber auch als polarisierend. Der ABC-Slogan ("anybody but Clinton") macht erneut die Runde, viele mögen die ehemalige First Lady nicht mehr sehen. Unterstützt wird diese Stimmung durch Bücher wie das des Watergate-Enthüllers Carl Bernstein, der der Kandidatin eine Mischung aus Opportunismus und Karrierismus unterstellt. Ob er sie mag? "Ich würde gern", sagt Bernstein.
Besonders gemocht werden möchte John Edwards. Der ehemalige Senator aus North Carolina betont stets seine einfache Herkunft und seinen Willen, gegen die Armut und Ungleichheit im Lande zu vorzugehen. Gleichzeitig gönnt sich der millionenschwere Staranwalt eine 400-Dollar-Fönfrisur – sehr zur Freude der Late-Night-Talker und Republikaner. Immerhin hat der Mann inzwischen eine eindeutige Meinung zum Irak-Krieg gefunden ("meine Entscheidung für den Waffengang war ein Fehler") und wagt es, Hillary zu attackieren. Auch sie solle ihre Entscheidung von damals revidieren.
Barack Obama hingegen, erst seit zweieinhalb Jahren als Senator in Washington, tritt so zahm und zurückhaltend auf, dass viele vermuten, er spekuliere nunmehr auf den Vizeposten – unter Clinton. Die New York Times hat dazu schon den passenden Namen kreiert: "Obambi". In Umfragen festigt dieser den zweiten Platz. Weit hinter Hillary.
Etwas unübersichtlicher gestaltet sich die Situation bei den Republikanern. An der Spitze: Rudi Giuliani, Held des 11. September. Dahinter rangeln sich Senator John McCain und Ex-Gouverneur Mitt Romney. Auf einen Durchmarsch Giulianis mag aber kaum jemand setzen. Der ehemalige New Yorker Bürgermeister bugsiert sich mit seinen einsamen Positionen (für das Recht auf Abtreibung, für schärfere Waffengesetze und für homosexuelle Lebensgemeinschaften) in die Dauerdefensive jeder Debatte. Umso lieber spricht er vom Terrorismus.
McCain gilt innerhalb seiner Partei als jemand, der zur Not mit dem Teufel paktiert. In diesem Falle mit Ted Kennedy bei einem Gesetzentwurf zur Einwanderungsfrage. Außerdem unterstützt der prinzipientreue Vietnamveteran die Irakpolitik des Präsidenten – und hat sich damit das Prädikat "unwählbar" erworben. Romny schließlich hat bewiesen, dass er seine Meinung geschmeidig zu ändern versteht. In der Demokraten-Hochburg Massachusetts gab er sich als Gouverneur liberal, jetzt auf Bundesebene markiert er den standhaften Verfechter konservativer Grundwerte. Als Handicap gilt sein Glauben: Romny ist Mormone, einer Kirche, die vielen höchst suspekt erscheint.
Angesichts dieser Auswahl hoffen beide Lager noch auf den großen Heilsbringer. Bei den Republikanern wird über einen Spätstart des ehemaligen Senators Fred Thompson spekuliert, der, da Schauspieler, Erinnerungen an die glorreiche Reagan-Ära weckt. In Washington jedoch lästern viele, dass Thompson auch seine Abgeordnetenrolle seinerzeit nur gespielt habe. Kein Gesetz, keine Initiative werde mit dem Namen Thompson in Verbindung gebracht. Der Politiker fiel vor allem wegen seiner Größe auf (2 Meter) – und wegen seiner demonstrativen Ablehnung des Washingtoner Politikbetriebes.
Bei den Demokraten setzen viele bezeichnenderweise auf den Verlierer des Jahres 2000, Al Gore. Gore, ehemaliger Vizepräsident und aktueller Umweltpapst, wird noch am ehesten zugetraut, den Clinton-Express zu stoppen. Vergessen und vergeben offenbar die Wahl 2000, die viele auch im Nachhinein für eigentlich unverlierbar hielten. Der zuweilen arrogante und stocksteife Gore habe Bush erst möglich gemacht.
Die beiden potenziellen Hoffnungsträger wissen genau: Haben sie erst einmal ihre Kandidatur erklärt, werden sie in der Medienmaschinerie schnell zerpflückt – und auf Normalmaß reduziert. Vielleicht bleiben sie also besser in der Reserve.
Quelle: ntv.de