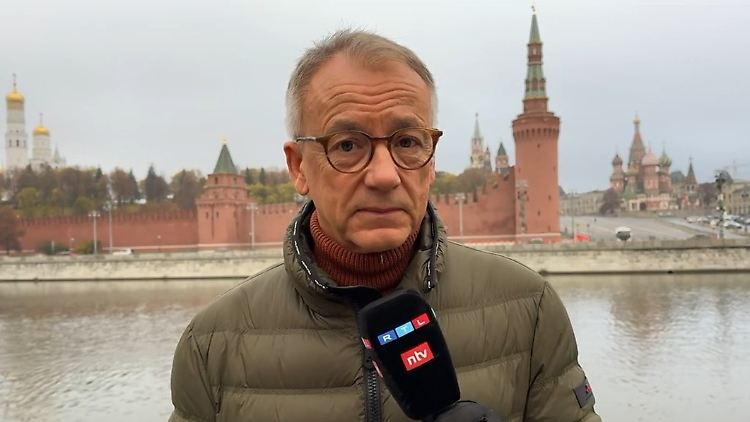Göttinger Erklärung "Wir können nicht schweigen"
10.04.2007, 09:18 UhrVor 50 Jahren häuften sich auf dem Schreibtisch des Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft in Göttingen, des Atomphysikers Otto Hahn, Glückwunschtelegramme aus aller Welt. Am 12. April 1957 hatten 18 führende deutsche Naturwissenschaftler, darunter vier Nobelpreisträger, von Zweifeln und Gewissensnöten gedrängt in der so genannten "Göttinger Erklärung" vor den Gefahren des atomaren Wettrüstens gewarnt. Sie wandten sich strikt gegen die Aufrüstung der Bundeswehr mit Atomwaffen.
Heute ist dieser Appell mit dem Titel "Wir können nicht zu allen politischen Fragen schweigen" längst verklungen. Es gibt bisher kaum offizielle Reaktionen auf den kommenden Gedenktag. Nur Heimatforscher aus Kaufbeuren im Allgäu erinnern daran, dass der Sohn ihrer Stadt und ehemalige Vizepräsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Wilhelm Walcher, zu den Mitunterzeichnern gehörte.
Der machtbewusste Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU) soll getobt haben, als er vom Widerspruch der Forscher hörte. Erst kurz zuvor hatte er die taktischen Atombomben als "Weiterentwicklung der Artillerie" bezeichnet. "Zur Beurteilung dieser Erklärung muss man Kenntnisse haben, die diese Herren nicht besitzen", schrieb er. Der "Spiegel" spielte auf die Ehrungen des Kanzlers an und sah "14 Doktorhüte von Adenauer, der nie einen Doktor gemacht hat, in der Waagschale gegen 18 weltbekannte Wissenschaftler". Das Bemühen von Hahn, Werner Heisenberg, Carl Friedrich von Weizsäcker und Max von Laue, Adenauer in einem Gespräch zum Umdenken zu bringen, blieb erfolglos. Kurz darauf kamen die ersten Atomwaffen in die Bundesrepublik.
"Die Unterzeichner fühlen sich verpflichtet, auf einige Tatsachen hinzuweisen, die alle Fachleute wissen, die aber der Öffentlichkeit noch nicht ausreichend bekannt zu sein scheinen", heißt es in dem Manifest. Danach folgt eine präzise Beschreibung der möglichen ungeheuren Zerstörungen ganzer Landstriche durch Atom- und Wasserstoffbomben. Die Bedrohung sei "lebensausrottend, ohne eine einzige technische Lösung große Bevölkerungsgruppen vor der Gefahr sicher zu schützen". Gleichzeitig kündigten die Forscher an, "die friedliche Nutzung der Kernenergie mit allen Mitteln zu fördern".
Hahn und seiner Assistentin Lise Meitner war 1938 das historische Experiment der Atomspaltung gelungen. Die dramatische Entwicklung der Atomtechnik hatten sie damals nicht ahnen können. Meitner musste als Jüdin Deutschland verlassen, Hahn forschte im Krieg weiter. Warum es ihm und anderen deutschen Wissenschaftlern nicht gelang, die Atombombe zu entwickeln, ist bis heute umstritten. Über eines sind sich die Biografen jedoch einig: Als er 1945 in britischer Gefangenschaft den Nobelpreis für Chemie erhielt, mischte sich in die Freude die Furcht, wie die Menschheit mit dem Wissen, das er ihr gegeben hatte, umgehen würde. Nach den Atombombenabwürfen der Amerikaner in Japan plagte er sich nach Ansicht vieler Biografen mit Selbstmordgedanken.
Auch Hahns Mitstreiter Heisenberg, der nach der Kapitulation Deutschlands 1945 ebenfalls nach England gebracht worden war, hatte früh vor der Atombombe gewarnt. Entsetzen auch bei ihm, als die Bomben von Hiroshima und Nagasaki Hunderttausende töteten oder verstrahlten. Offen trug Heisenberg seine Kontroversen mit Adenauer aus. Der Regierungschef versuchte sogar, dessen öffentliche Vorträge zu unterbinden.
Rund ein Jahr nach der Veröffentlichung der "Göttinger Erklärung" bekamen die deutschen Atomgegner dann organisierte politische Unterstützung von der Opposition: Die SPD gründete 1958 das Komitee "Kampf dem Atomtod". Weitere zwei Jahre später fand nach britischem Vorbild der erste deutsche Ostermarsch gegen die atomare Bewaffnung statt. Als Kampagne gegen Krieg, Rüstung und Auslandseinsätze der Bundeswehr gibt es diese Aktionen bis heute. In diesem Jahr beteiligten sich mehrere zehntausend Menschen. US-Atomwaffen sind in Deutschland jedoch weiter stationiert.
(Werner H. T. Fuhrmann, dpa)
Quelle: ntv.de