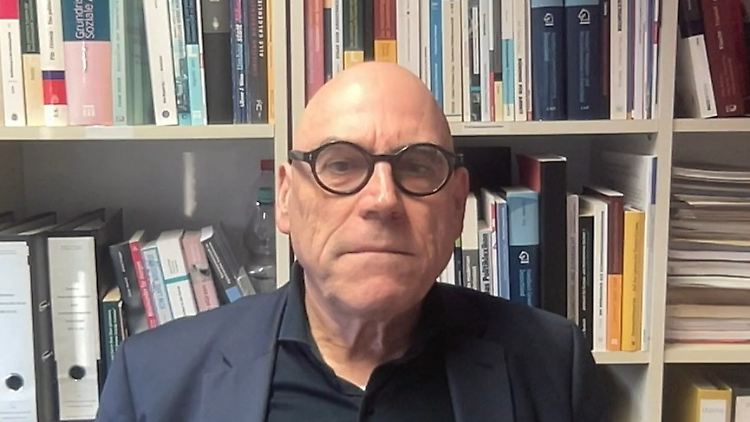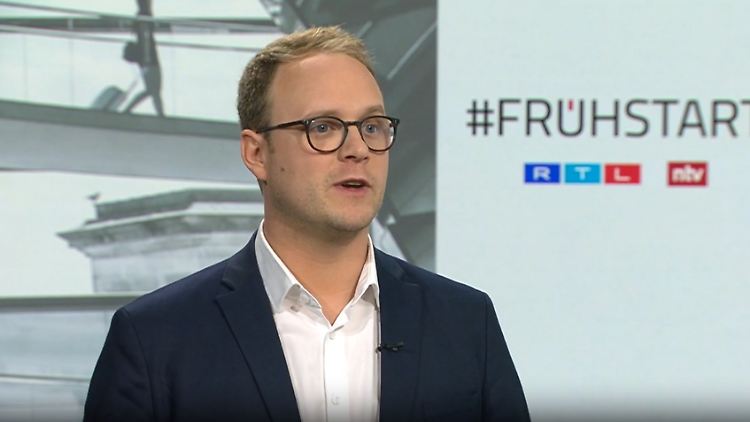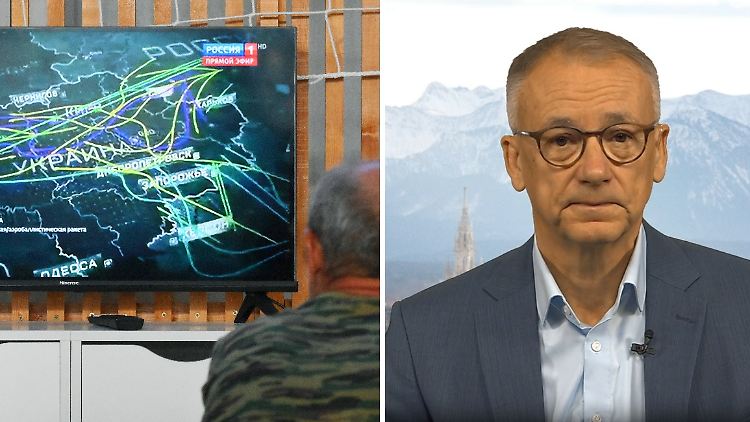Zwischenruf Steinbach greift zu kurz
05.08.2010, 17:57 Uhr
Erika Steinbach würdigt "die Charta der Vertriebenen" als "Absage an Revanche und Gewalt".
(Foto: REUTERS)
Die unkritische Würdigung der Gründungscharta durch den Bund der Vertriebenen offenbart: Geschichtsrevisionistische Vorstellungen sind längst nicht überwunden.
Es ist gut, dass Bundestagspräsident Norbert Lammert die Forderung seiner Parteifreundin Erika Steinbach zurückgewiesen hat, am 5. August künftig einen "Vertriebenen-Gedenktag" zu begehen. Zum einen, weil die "Charta der Vertriebenen" an diesem Datum vor 60 Jahren als Reaktion auf die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie durch die DDR am 6. Juli 1950 erfolgte. Der durch das Bundesverfassungsgericht festgeschriebene Fortbestand des Deutschen Reiches in seinen Grenzen von 1937 war der Stolperstein in den 2plus4-Verhandlungen, die die äußeren Bedingungen für die deutsche Einheit herstellten. Ohne die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze hätte Polen nie seine Zustimmung gegeben. Abermalige ernste Spannungen in den Beziehungen zu Warschau und Prag wären die Folge gewesen. Der monatelange Streit um die Entsendung von Erika Steinbach, Präsidentin des Bundes der Vertriebenen (BdV), in den Rat der aus Steuermitteln finanzierten Stiftung "Flucht, Vertreibung, Versöhnung" namentlich mit Polen offenbart die aktuelle politische Brisanz von Geschehnissen, die mehr als ein halbes Jahrhundert zurückliegen.
Wenn Frau Steinbach nun erklärt, die Bedeutung der Charta könne nicht hoch genug eingeschätzt werden, greift sie zu kurz. Zweifellos war der Gewaltverzicht positiv. Aber schon der Verzicht auf "Rache" impliziert, dass es etwas gab, wofür man sich hätte rächen können. Die Forderung, die "Völker der Welt … (sollten) … ihre Mitverantwortung am Schicksal der Heimatvertriebenen als der vom Leid dieser Zeit am schwersten Betroffenen empfinden", blendet die alleinige Verantwortung Hitlerdeutschland für den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges völlig aus. Das Postulat des "Recht(s) auf Heimat" wurde über Jahrzehnte als Recht auf Rückkehr oder gar Wiedergewinnung der einstigen deutschen Ostgebiete interpretiert.
Jüngste Erklärungen führender Vertreter des Bundes der Vertriebenen machen deutlich, dass geschichtsrevisionistische Vorstellungen keineswegs überwunden sind. Der Vorsitzende des baden-württembergischen BdV-Landesverbandes, Arnold Tölg, schwadroniert über einen "langfristigen Plan" Polens und Tschechiens (?), die "schon 1848 eine … Linie Stettin-Triest herstellen" wollten. Abgesehen davon, dass beide Länder damals nicht existierten, unterstellt der Christdemokrat, dass "der von Hitler ausgelöste Krieg … den Ländern, die die Deutschen vertrieben haben, eine Chance gegeben hat, die Deutschen loszuwerden". Tölg sitzt nun anstelle von Frau Steinbach im Rat der Stiftung "Flucht, Vertreibung, Versöhnung". Gegen deren Entsendung hatte Bundesaußenminister Guido Westerwelle mit Blick auf Polen zu Recht Widerspruch eingelegt. Da mutet es schon fast wie ein Wunder an, dass es im Stuttgarter Neuen Schloss nur vereinzelte Buhrufe gegen den Vizekanzler gab.
Manfred Bleskin kommentiert seit 1993 für n-tv das politische Geschehen. Er war zudem Gastgeber und Moderator verschiedener Sendungen. Seit 2008 ist Bleskin Redaktionsmitglied in unserem Hauptstadtstudio in Berlin.
Quelle: ntv.de