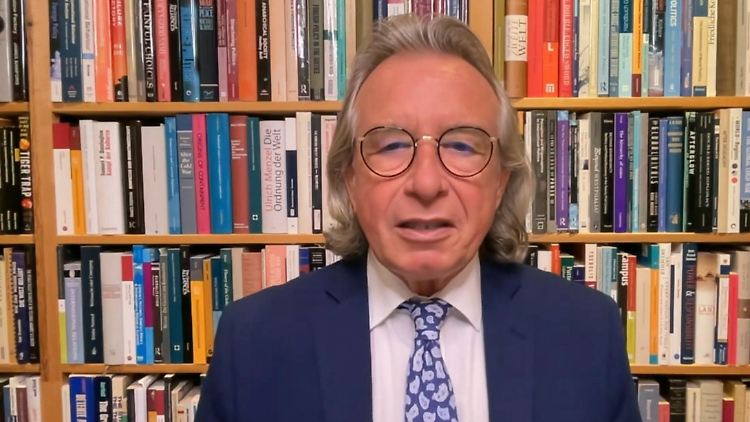Die Urwahl und das grüne Dilemma Machtgier steht den Grünen schlecht
02.09.2012, 04:44 Uhr
Jürgen Trittin galt schon seit Monaten als gesetzt für einen Platz im Spitzenduo. Jetzt muss er trotzdem darum kämpfen.
(Foto: picture alliance / dpa)
Der Länderrat der Grünen tritt zusammen, um zu entscheiden, ob die Mitglieder der Partei ihre Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl per Urwahl bestimmen sollen. Ein Ja gilt als sicher. Die Top-Grünen bürden sich damit einen Wettstreit auf, in dem es nur Verlierer geben kann.
Das Dilemma der Grünen begann mit einer Fußballanalogie eines völlig unbekannten Parteimitglieds. In gab der Ortsvorsitzende der Grünen in Waiblingen, Werner Winkler, im März Einblick in seine Denke: "Die Dortmunder Fußballer sind deshalb so gut, weil es Konkurrenz und fairen Wettbewerb gibt", erklärte er. Winklers Schlussfolgerung: Auch die Grünen brauchen Konkurrenz und Wettbewerb, um vor dem großen Finale, der Bundestagswahl, zu erstarken.
Damals hatte sich Parteichefin Claudia Roth gerade für einen Platz im Spitzenkandidatenduo der Partei beworben. Als profiliertester Grüner galt Fraktionschef Jürgen Trittin schon seit Monaten als gesetzt. Wo war da die Konkurrenz? Wo war da der Wettbewerb? Das muss sich Winkler in diesen Tagen gedacht haben und bewarb sich ebenfalls für das Amt. Er hoffte darauf, die Partei so zu einer Urwahl zu zwingen.
Ein halbes Jahr später ist der Wunsch des Ortsvorsitzenden so gut wie Wirklichkeit geworden: Wie die hochbezahlten Stars von Borussia Dortmund müssen auch die potenziellen Spitzenkandidaten der Grünen um ihre Führungsrolle im Team kämpfen. Das wird der Länderrat der Partei aller Voraussicht nach beschließen, denn es gibt deutlich mehr Bewerber als Ämter. In den nächsten Wochen bestimmen dann die 60.000 Parteimitglieder, wer ihre Partei in Wahlkampfzeiten repräsentieren soll. Anders als von Winkler erhofft, wird das aber nicht dazu führen, dass die Grünen an dem Wettstreit wachsen. Bis das Ergebnis der Urwahl im November feststeht, werden sich die Anwärter auf die Spitzenposten einen absurden Kampf liefern, der nur Verlierer zurücklassen wird.
Keine Spur mehr von Basisdemokratie
Es waren die Grünen, die Ende der 70er-Jahre das Rotationsprinzip erfanden. Es sah vor, dass Abgeordnete ihren Posten regelmäßig wieder abgeben müssen – mitunter mitten in einer Legislaturperiode. Ziel war es, zu verhindern, dass einige wenige Grüne Ämter anhäufen, dass sich allzu starke Machtzirkel entwickeln. Dahinter stand stets die Überzeugung, dass die Grünen eine basisdemokratische Partei sind, bei der es nicht um einen berufspolitikerartigen Personenkult, sondern um Inhalte geht.
Das Rotationsprinzip erwies sich schon in den 80er-Jahren nicht als praxistauglich – doch das Image, dass die Grünen anders Politik betreiben als die damals etablierten Parteien, konnten sie sich noch lange bewahren. Die Wahl eines Spitzenkandidatenduos aber - es ist die erste in der Geschichte der Partei - zeigt nun, wie weit sich die Grünen mittlerweile davon entfernt haben. Paradox, denn eigentlich ist die Urwahl ja durchaus basisdemokratisch. Doch dieser Tage lenkt sie den Blick vor allem darauf, wie die Parteispitze heute wirklich tickt.
Verstrickt in Flügel- und Geschlechterkämpfe
Es geht mehr denn je um Personen und Macht, nicht um Inhalte. So war der Anstoß für Roths Kandidatur nicht, dass sie Positionen vertrat, für die sich kein anderer einsetzte. Roth kandidierte, weil es für kurze Zeit zumindest denkbar erschien, dass Trittin die Partei allein in die Wahl führen könnte. Es ging ihr um den Geschlechterproporz: In einem Interview mit der "Tageszeitung" sagte sie: "Die Quote macht einen großen Teil unseres Erfolges aus." Dass ein einzelner Mann die Partei in den Bundestagswahlkampf führt, "wird es mit mir als Parteichefin nicht geben", so Roth.

Künast, Trittin, Roth, Özdemir (v.l.o.) - mit ihren Partei- und Fraktionschefs haben die Grünen eigentlich schon ausreichend Köpfe, die sie bei der Bundestagswahl verkörpern können.
(Foto: picture alliance / dpa)
Als eine Urwahl nach Winklers Vorstoß dann ohnehin unabwendbar erschien, warf auch Fraktionschefin Renate Künast ihren Hut in den Ring. Auch sie setzt sich inhaltlich kaum von anderen Grünen ab. Ein Trittin etwa unterscheidet sich mittlerweile lediglich durch das Image von ihr. Gefühlt ein linker Grüner, betreibt er eine Realpolitik, die der einer Künast in nichts nachsteht.
Die Fraktionschefin kandidierte offensichtlich aus zwei Gründen: Um nach ihrer schweren Niederlage bei der Berliner Bürgermeisterwahl ihren Einfluss unter den Realos wieder zu festigen, und um das absurde, weil nur noch theoretische Gleichgewicht zwischen diesem und dem linken Flügel der Partei zu erhalten. Kein anderer Grund führte dazu, dass dann auch die Realos, die nicht mehr hinter Künast standen, Katrin Göring-Eckardt dazu drängten sich ebenfalls für das Amt zu bewerben. Seit sich die Grünen der Spitzenkandidatendebatte widmen, ist zu beobachten, wie Individuen und Flügel um ihre Stellung kämpfen. Mit der bevorstehenden Urwahl dürfte sich das nur verschärfen.
Den Stars von Borussia Dortmund mag ihr Ehrgeiz gut zu Gesicht stehen. Die Grünen macht er unauthentisch. Fast schon autistisch übersehen die Spitzenpolitiker, dass die Wähler die parteiinternen Streitereien für albern halten. Denn während sich ein Großteil der Energie der Partei jetzt auf die einzelnen Personen konzentrieren wird, ist es allzu offensichtlich, dass die Partei überhaupt keine Spitzenkandidaten braucht. Zum einen hat sie schon einen fein säuberlich quotierten Partei- und Fraktionsvorstand. Mit Trittin, Roth, Künast und Cem Özdemir weitgehend die Gesichter, die die Partei wohl auch nach der Urwahl verkörpern dürften. Und zum anderen schwanken die Grünen in der wöchentlichen seit langem zwischen 12 und 13 Prozent. Sie werden nicht den Kanzler stellen.
Besonders stark waren die Grünen stets, wenn es um ihre Themen ging. Bestes Beispiel dafür ist das Umfragehoch nach der Fukushima-Katastrophe. Darauf sollte sich die Partei wieder besinnen.
Quelle: ntv.de