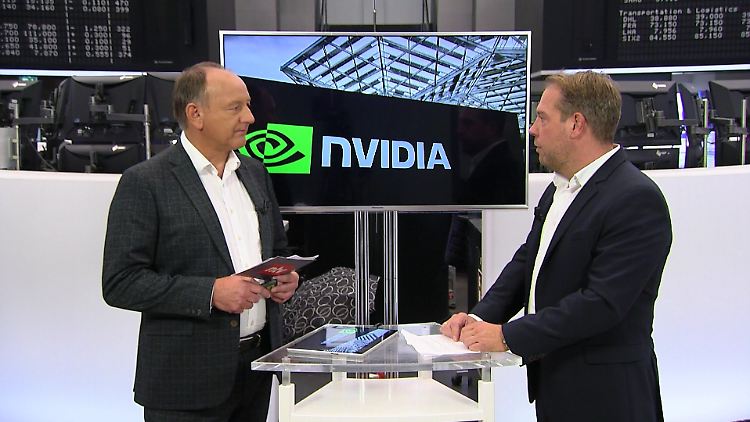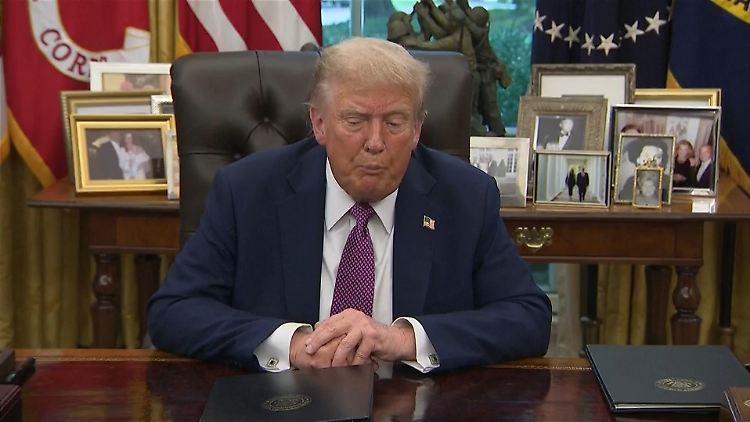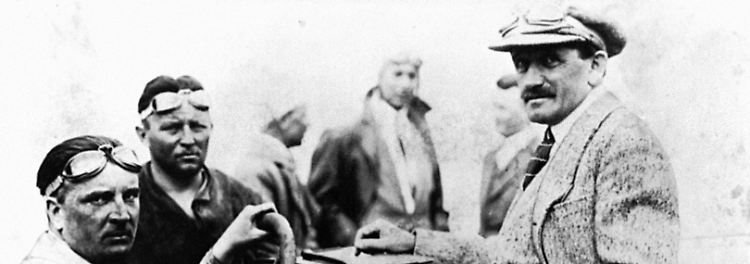Investmentbanker in der Krise Anzug statt Büßerhemd
16.07.2009, 16:18 Uhr
Bei Lehman Brothers mussten Banker ihre Kisten packen - andernorts wird munter weitergezockt.
(Foto: REUTERS)
Die Investmentbanken sind tot - die Investmentbanker leben. Doch ihr Geschäft ist ein anderes geworden seit dem 15. September 2008. Entspannter, langweiliger - und weniger lukrativ. "Die Lehman-Pleite hat diese Welt verändert", sagt ein Banker, der bis vor wenigen Monaten an jenen großen, schuldenfinanzierten Übernahmen gearbeitet hat, die es in der Finanzkrise kaum noch gibt. "Das hat viel Spannung aus dem Geschäft genommen", bedauert er. Und damit gibt es die Millionen-Boni nicht mehr, an denen sich die Banker berauschten - und die Branche in Verruf brachten.
Momentan köchelt das Geschäft mit Fusionen und komplizierten Finanzprodukten auf Sparflamme - doch die Branche positioniert sich längst für den nächsten Boom. Viele Lehman-Leute sind bei anderen Banken untergekommen, sie arbeiten an der Sanierung der Firmen, die sie einst gebaut oder mit Schulden überladen haben. Oder sie machen weiter wie bisher, nun aber etwa für Barclays oder Nomura, die die Reste von Lehman aufgesogen haben und nun selbst im Investmentbanking ein großes Rad drehen wollen.
Eine Woche nach dem Zusammenbruch der US-Investmentbank vor zehn Monaten wandelten sich die einzigen noch selbstständigen Branchengrößen Goldman Sachs und Morgan Stanley in normale Geschäftsbanken. Damit unterwarfen sie sich zwar einer strengeren Aufsicht. Doch das Geschäftsmodell blieb das gleiche. Sparkonten von Privatkunden sind für sie weiter kein Thema. Bear Stearns war schon im Frühjahr 2008 von JP Morgan gekauft und damit vor dem Absturz bewahrt worden. Merrill Lynch ging zeitgleich mit der Lehman-Pleite an die Bank of America.
Neue Mitspieler
"Wir sind in einer Phase der Umschichtung", sagt Claus Peter von der Frankfurter Privatbank Metzler. "Wer sich jetzt richtig aufstellt, wird Marktanteile gewinnen." Neue Namen sind im Spiel. Die japanische Bank Nomura hat mit der Übernahme des Europa-Geschäfts von Lehman die Zahl ihrer Investmentbanker am Main verdreifacht. Die neuen Leute prägen das Klima so, dass Insider von einer De-facto-Übernahme durch Lehman sprechen. Der neue Deutschland-Co-Chef Patrick Schmitz-Morkramer, ein früherer Lehman-Banker, sagt, das Geschäft komme schon wieder in Schwung.
Die Lehman-Banker in Amerika hat die britische Bank Barclays übernommen. Auch das bleibt in Deutschland nicht ohne Folgen. Barclays stellt ein. "Wir wollten eigentlich nie ins Aktien- und M&A-Geschäft", gesteht Geschäftsführer Omar Selim. "Aber es wäre töricht gewesen, 10.000 Leute in den USA zu haben, ohne das Geschäft in Europa und Asien aufzubauen." Doch die Banker stehen nicht Schlange. "Es wird schwieriger, neue Leute anzuheuern. Die Preise steigen wieder", sagt Selim.
Durchwachte Nächte sind passé
Früher waren es die Boni, die lockten, hohe Boni, die Josef Ackermann mit einem zweistelligen Millionen-Chefgehalt nur zur Nummer 13 auf der Gehaltsliste der Deutschen Bank machten. Der dicke Topf wurde vor allem bei den großen Finanzierungen aufgemacht, bei denen die Banken selbst ins Risiko gingen. Bei einer Zwei-Milliarden-Übernahme konnten das 30 Millionen Euro an Gebühren sein, an denen die Banker partizipierten. "Dafür haben die Leute auch 48 Stunden durchgearbeitet, mit viel Koffein", erzählt ein Banker. "Wie wollen sie die Leute ohne Boni künftig motivieren? Woanders arbeiten sie weniger und bekommen gleich viel."
Aber große Transaktionen sind Mangelware, und große Risiken wie früher gehen die Institute kaum ein. Kredit-Pakete über 30 Millionen Euro sind nun die Schallmauer. "Das Risikomanagement hat sich komplett verändert", sagt Barclays-Banker Selim. "Wir werden in sehr viel bessere Zeiten kommen." Leichter und weniger riskant verdient ist das Geld anderswo: mit Unternehmensanleihen etwa, die die schwieriger zu ergatternden Bankkredite ersetzen.
Goldman Sachs schrieb im zweiten Quartal schon wieder einen Milliardengewinn, auch die Deutsche Bank verdient mit Anleihen gut. "Ehrlich gesagt, ist die Konkurrenz am Markt deutlich weniger geworden", konstatiert Goldman-Finanzchef David Viniar. Seinen Angestellten winken in diesem Jahr Gehalt und Boni von bis zu einer Million Dollar - im Schnitt.
Die Gier bleibt
Von Reue ist wenig zu spüren. "Wir waren zu gierig", "der Markt war überhitzt", räumen die Banker gerne ein. Doch das verbale Büßerhemd wird schnell gegen Anzug und Manschettenknöpfe getauscht. Schon sind neue strukturierte Produkte auf dem Markt - nur schlichter und etwas konservativer als ihre Vorgänger, von denen viele heute als "toxisch" bezeichnet werden. "Man hat gedacht, man könnte aus Blei Gold machen", sagt Heike Munro, die sich bei Rothschild um Restrukturierungsfälle kümmert.
"Wir können nur auf die Vernunft hoffen, sonst rennen wir in die nächste Luftblase", mahnt ein erfahrener Banker. "Ich glaube kaum, dass sich viel ändern wird. Auch die nächste Generation wird von Gier getrieben sein", prophezeit ein Kollege.
Quelle: ntv.de, rts