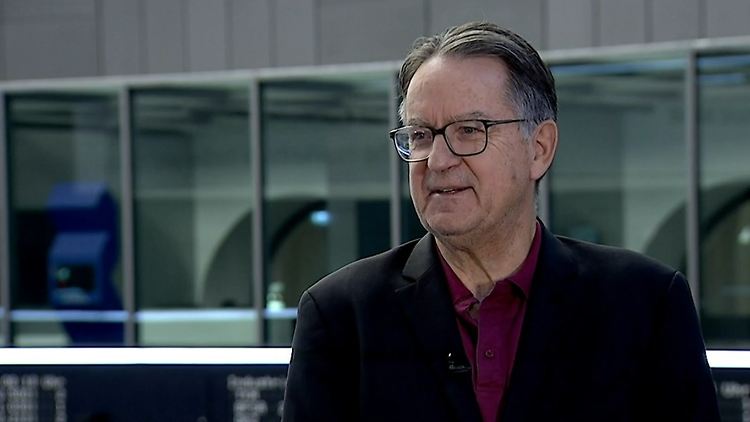Eiszeit zwischen Merkel und Ackermann Banken bangen um Einfluss
28.05.2010, 17:08 Uhr
Sie verstanden sich mal blendend: Angela Merkel und Josef Ackermann (Archivfoto vom 14.12.2008).
(Foto: picture-alliance/ dpa)
Einst war Ackermann der erste Ansprechpartner auf der Bankenseite für Merkel. Heute wird seine Stimme in Berlin nicht gern gehört. Misstrauen beherrscht das Verhältnis.
Eine weitere Geburtstagsfeier im Kanzleramt wird es für Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann wohl vorerst nicht geben. Denn ausgerechnet in der größten Wirtschaftskrise ist das Verhältnis von Deutschlands mächtigstem Banker zu Deutschlands mächtigster Politikerin empfindlich abgekühlt. Spätestens seit Ackermann vor laufender Kamera die Kreditwürdigkeit Griechenlands anzweifelte, ist die Stimmung zwischen den Frankfurter Bankengrößen und der Berliner Politik an einem neuen Tiefpunkt angekommen.
Zwar hält sich Bundeskanzlerin Angela Merkel mit öffentlicher Kritik zurück. Dafür haben Finanzminister Wolfgang Schäuble und Wirtschaftsminister Rainer Brüderle klargemacht, was man in Berlin vom politischen Gespür Ackermanns hält - nicht viel. "Überraschend, ungewöhnlich, ärgerlich", schimpfte Brüderle über Ackermanns Griechenland-Skepsis.
Moll-Töne dominieren

Ackermann schießt auf der Hauptversammlung der Deutschen Bank gegen die Regierung in Berlin (Archivbild vom 27.05.2010).
(Foto: dpa)
"Man hat sich derzeit nicht viel zu sagen", heißt es wiederum in der Frankfurter Bankzentrale. Die Moll-Töne stehen geradezu sinnbildlich für das Verhältnis der gesamten Finanzbranche zur Politik: Einen Dialog gibt es kaum, wie das jüngste Beispiel des Leerverkaufsverbots zeigt, das die Regierung durchsetzte, ohne die Branche wie sonst üblich einzubinden. Jetzt kündigte die Finanzaufsicht trotz der Kritik auch noch an, sie plane nun ein dauerhaftes Verbot.
In der hitzig geführten Regulierungsdebatte bangen die Banken deshalb um ihren Einfluss in Berlin. In den Frankfurter Hochhäusern wächst die Angst vor Verboten, die den deutschen Finanzplatz nachhaltig treffen könnten. "Wer die Banken und Märkte zu stark reglementiert und in ihrer Leistungsfähigkeit einschränkt, trifft am Ende Wirtschaft und Gesellschaft", warnte deshalb Ackermann in dieser Woche. Auch Finanzexperten machen sich Sorgen: "Die Politik versteht nicht, wie die Märkte funktionieren", kommentierte etwa Martin Faust, Professor an der Frankfurt School of Finance, vor kurzem die als zögerlich kritisierte Haltung der Regierung in der Griechenland-Rettung.
Liebesentzug für eigennützige Berater
Ackermanns Möglichkeiten, der Politik Nachhilfe zu geben, haben stark nachgelassen. Früher wurde dem Chef der Deutschen Bank große Nähe zur Kanzlerin nachgesagt - so sehr, dass er in Zeitungskommentaren schon als "Merkels Chefberater" tituliert wurde. Immerhin war der Schweizer bei der Rettung der Hypo Real Estate oder der IKB der erste Ansprechpartner auf Bankenseite für Merkel.
Diese Rolle spielt er heute nicht mehr. Es sei gar nicht einfach, unter den Finanzexperten uneigennützige Ratgeber zu finden, soll die Kanzlerin unlängst auf einer Veranstaltung in Berlin gesagt haben. Der Platz für ehrliche Berater sei noch frei. In Berlin würdigt man zwar, dass Ackermann die größte deutsche Bank als einzigen Spieler des Landes international platzieren konnte. Ihm wird zudem große Expertise in der Beurteilung von Märkten zugebilligt. Schon deshalb werde sein Rat geschätzt - von Zeit zu Zeit.
Neutralität war einmal
Aber als der erhoffte neutrale Finanzexperte ohne eigene Interessen wird Ackermann eben nicht mehr gesehen. Nun begegnen sich beide Welten mit mehr Misstrauen als früher - nicht nur, weil sich die nüchterne Merkel und der schillernde Ackermann auch in ihren Persönlichkeiten unterscheiden. Nicht wenige schüttelten in Berlin den Kopf, als Ackermann sich im vergangenen Jahr öffentlich brüstete, die Kanzlerin habe nur für ihn ein Geburtstagessen im Kanzleramt organisiert.
Doch es geht um mehr als Eitelkeiten. Der Populismus-Vorwurf aus der Finanzwelt prallt auf den Vorwurf der Politik, die Akteure der Märkte verstünden offenbar nicht, wie eine Demokratie funktioniere. Eine deutsche Regierungschefin müsse eben Rücksicht auf parlamentarische Mehrheiten nehmen und diese erst einmal organisieren. Der Zwang zum Kompromiss sei größer, als in Frankfurt vermutet werde. "Politik funktioniert anders als ein Unternehmen", sagt ein führender Bundespolitiker.
Scheiden tut weh
Doch der Liebesentzug tut Ackermann nun offenbar spürbar weh: Auf der Hauptversammlung der Deutschen Bank feuerte er erneut in Richtung Berlin und geißelte die "Polit-Rhetorik" als wenig zielführend. Es sei wichtig, dass sich beide Seiten besser zuhörten und mehr miteinander als übereinander redeten, sagte er trotzig. In Berlin heißt es dagegen lapidar, natürlich hätten die Regierung und sicher auch die Kanzlerin immer ein offenes Ohr für wichtige Vertreter der deutschen Wirtschaft.
Quelle: ntv.de, Philipp Halstrick und Andreas Rinke, rts