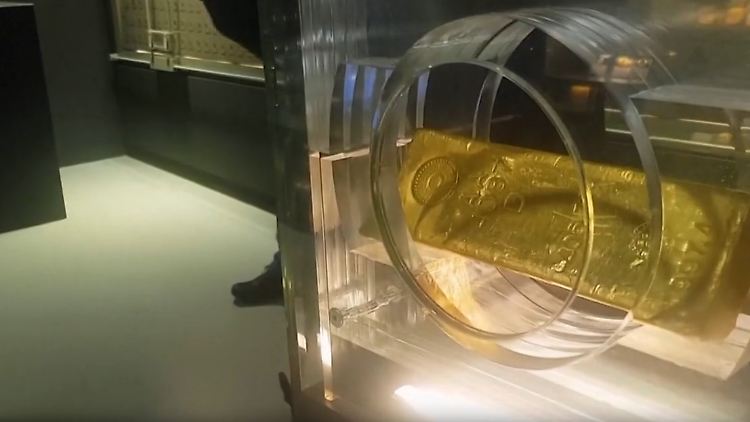Leitzins könnten weiter sinken Euro-Notenbanker legen nach
12.07.2012, 21:12 Uhr
(Foto: AP)
Nach der jüngsten Senkung des Leitzinses der EZB auf das historische Tief von 0,75 Prozent reden Zentralbanker bereits öffentlich über eine erneute Senkung. An der Preisfront drohen den Währungshütern derzeit keine Störfeuer. Wohl auch deshalb kann Österreichs Zentralbanker Nowotny über Wachstumsmotive der Geldpolitiker reden.
Die Euro-Notenbanker könnten bei einer Verschlechterung der Konjunktur beim Leitzins nachlegen. Gegenwind durch einen zu hohen Teuerungsdruck dürften sie bei einer möglichen weiteren Zinssenkung in den kommenden Monaten jedenfalls nicht bekommen. Mit den Wirkungen ihrer jüngsten geldpolitischen Entscheidungen können sie allerdings, wie sich aus Daten der EZB ablesen ließ, nicht zufrieden sein.
Nach EZB-Präsident Mario Draghi zeigte sich auch der Chef der niederländischen Notenbank Klaas Knot offen für weitere Zinssenkungen. "Sollte sich die Lage verschlechtern, hindert uns kein Glaubensgrundsatz daran, auch unter 0,75 Prozent zu gehen", sagte Knot, der als Mitglied des EZB-Rats über die Zinshöhe mitentscheidet, in einem Interview der "Financial Times Deutschland". Die EZB hat ihren Leitzins vergangenen Donnerstag von einem auf 0,75 Prozent gesenkt, den niedrigsten Zinssatz seit Einführung des Euro.
Notenbank-Chef Draghi hatte am Montag vor dem Europäischen Parlament in Brüssel ebenfalls die Tür für weitere Zinssenkungen offengelassen. Er machte bei einer Konferenz im marokkanischen Casablanca jetzt deutlich, dass es von der Preisfront keinerlei Gegenargument gegen einen solchen Schritt und für höhere Zinsen geben wird. Der Zeitplan, in dem die Teuerung wieder unter das von der EZB gewünschte Ziel von zwei Prozent fallen werde, habe sich "Richtung Gegenwart verschoben". "Mit anderen Worten: die Inflation wird früher, als wir das zuletzt prognostiziert haben näher an unserem Ziel liegen", sagte der Italiener.
Keine Glaubensgrundsätze
Knot sagte in der FTD: "Früher dachten alle, ein Prozent sei die Zinsuntergrenze." Die jüngste Entscheidung habe gezeigt, dass das nicht so sein müsse. "Ich kann dazu nur sagen: 0,75 Prozent sind für uns kein Glaubensgrundsatz. Der einzige Glaubensgrundsatz, den wir haben, ist: Das Zinsniveau muss uns so nahe wie möglich an Preisstabilität auf mittlere Frist bringen, also an eine Inflationsrate von unter, aber nahe bei zwei Prozent im Eurozonen-Durchschnitt."
In Wien machte der Chef der österreichischen Zentralbank, Ewald Nowotny, unterdessen klar, dass er mit wachsender Sorge auf die wirtschaftliche Entwicklung auf dem Kontinent blickt. "Die Wachstumsperspektiven verschlechtern sich für ganz Europa", sagte er auf einer Konferenz des Internationalen Währungsfonds. Dies sei der Grund dafür gewesen, dass die EZB in der vergangenen Woche erstmals in ihrer Geschichte den Leitzins unter ein Prozent gesenkt habe.
Knot erklärte, bevor die Europäische Zentralbank eventuell eine noch weitere Absenkung des Einlagezinssatzes unter null Prozent in Erwägung ziehe, werde sie die Wirkungen prüfen: "Wir sehen uns genau an, was in Dänemark passiert, dort liegt der Einlagesatz jetzt bei minus 0,2 Prozent", sagte er. "Wir haben keine Erfahrung mit negativen Einlagezinsen. Wir sollten von den Erfahrungen anderer Länder mit Negativzinsen lernen, ehe wir entscheiden, ob das eine Option für uns ist."
Strich durch die Rechnung
Negative Einlagezinsen würden wie ein Strafzins für die Banken wirken. Die EZB senkte den Einlagenzinssatz vergangenen Donnerstag von 0,25 Prozent auf null - ebenfalls ein Novum, hinter dem ein ganz bestimmtes Kalkül steckt: die Hoffnung auf eine Verhaltensänderung der Geldhäuser.
Dass die Banken sich jedoch nicht so verhalten wie es die EZB sich wünscht und Überschussliquidität verwenden um sie anderen Banken oder Unternehmen zu leihen, war am Donnerstag aus EZB-Daten abzulesen: Hatten die Institute noch per Dienstag rund 800 Mrd. Euro zum bis dato gültigen Minizins von 0,25 Prozent bei der EZB geparkt, sank diese Summe bis Mittwochabend auf rund 325 Mrd. Euro. Die ebenfalls nicht verzinsten Zentralbankguthaben erhöhten sich allerdings parallel auf 540 Mrd. Euro von 74 Mrd. Euro. Unter dem Strich schichteten die Institute die Liquidität also nur um und machten vorerst keine Anstalten, den wegen der Krise darniederliegenden Geldmarkt wiederzubeleben.
Quelle: ntv.de, nne/rts