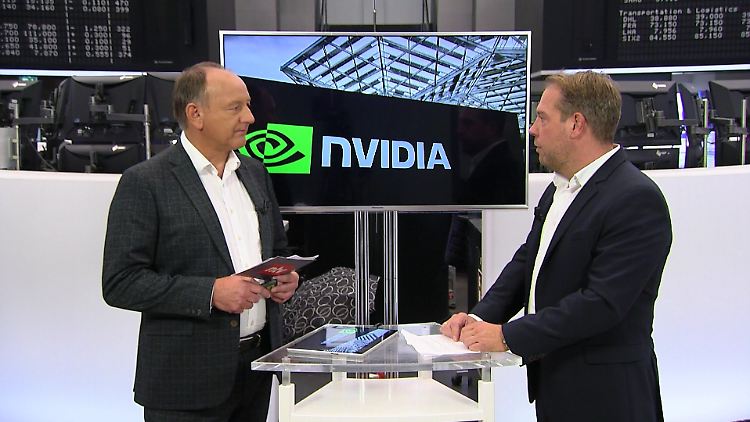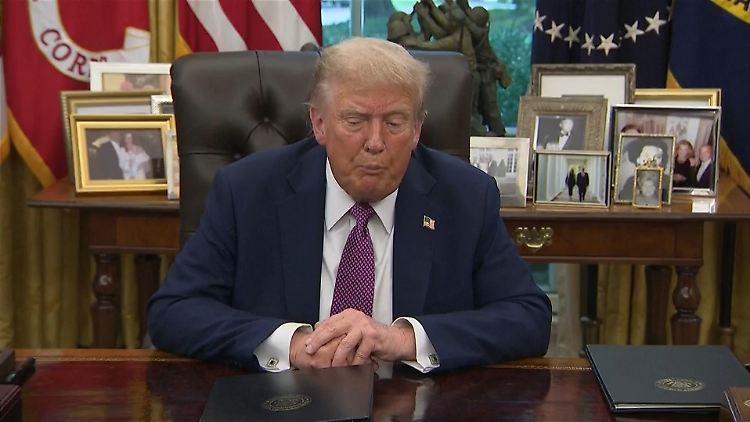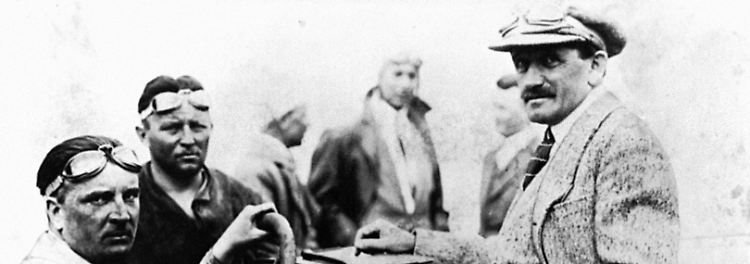Auf der Agenda des EU-Gipfels Rettung in fünf Schritten
24.03.2011, 12:11 Uhr
Wie stark profitiert Deutschland von der Währungsunion?
(Foto: picture-alliance/ dpa)
Der große Gipfel in Brüssel soll den Durchbruch bringen: Die Staats- und Regierungschefs Europas wollen ein Paket mit Maßnahmen gegen die Schuldenkrise verabschieden. Im Kern geht es um fünf Punkte, die den Euro dauerhaft stabilisieren sollen. Eine Übersicht.

Wenige Stunden vor dem EU-Gipfel muss Kanzlerin Angela Merkel im Bundestag erklären, wohin die Reise gehen soll.
(Foto: REUTERS)
Offiziell trägt der EU-Gipfel einen ganz anderen Namen: Die Staats- und Regierungschefs aus 27 Ländern treffen sich in Brüssel eigentlich zu einer "Frühjahrstagung zur Stabilität des Finanzsystems". In der Praxis spielt das jedoch eine untergeordnete Rolle. Der Gipfel ist eine Veranstaltung des "Europäischen Rates" und damit die zentrale Zusammenkunft des Gremiums, in dem "die allgemeinen politischen Zielvorstellungen und Prioritäten" der Europäischen Union festgelegt werden.
Die Staatsfrauen und Staatsmänner haben vereinbart, sich mindestens zweimal pro Halbjahr zu Beratungen zu treffen. Den Vorsitz führt der Präsident des Europäischen Rates, Herman Van Rompuy. An den Tagungen des Europäischen Rates nimmt Manuel Barroso als Präsident der EU-Kommission und Catherine Ashton als EU-Außenbeauftragte teil.
Nicht zu verwechseln ist der Rat der Europäischen Union mit dem Europäischen Rat, der informell auch als Ministerrat bezeichnet wird. Dem aktuellen Gipfel gingen ein Vorbereitungstreffen auf der Ebene der Finanzminister und eine informelle Tagung am 11. März voraus.

Kommissionspräsident Manuel Barroso (links) und Herman Van Rompuy lesen sich schon mal ein.
(Foto: AP)
Auf der Tagesordnung ganz oben steht das Paket mit Maßnahmen gegen die Euro-Schuldenkrise. Die Fragen zur Wirtschaftspolitik werden den Gipfel dominieren. Die aktuelle Regierungskrise im Euro-Mitglied Portugal dürfte kaum zu einem entspannten Gesprächsklima beitragen.
Das Maßnahmenpaket zur dauerhaften Stabilisierung der Währungsunion umfasst im Wesentlichen fünf Punkte:
Punkt 1: Der Euro-Rettungsschirm EFSF
Der provisorische Rettungsschirm EFSF soll aufgestockt werden. Dabei geht es vor allem um Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft am Kapitalmarkt. Um nach Irland auch auf finanzielle Notsituationen in eventuell größeren Staaten vorbereitet zu sein, soll der befristete Rettungsfonds künftig über ein Kreditvolumen von 440 Mrd. Euro verfügen. Bisher liegen 250 Mrd. Euro bereit.
Die Euro-Staaten haben bereits entschieden, dass der Fonds verstärkt wird, aber noch nicht, wie und wann. Diplomaten zufolge soll die Entscheidung darüber aus Rücksicht auf Finnland verschoben werden. Dort wird am 17. April ein neues Parlament gewählt. Eine Diskussion über eine Erhöhung der Garantien für den EFSF könnte der EU-kritischen Rechtspartei "Echte Finnen" Auftrieb geben. Sie will im Fall einer Regierungsbeteiligung über den Euro-Rettungsschirm neu verhandeln.

Das Sparpaket von Socrates sollte einen portugiesischen Hilfsantrag vermeiden: Finanzminister Fernando Teixeira dos Santos.
(Foto: AP)
Ein weiterer offener Punkt sind die EFSF-Konditionen für Irland. Die neu gewählte Regierung des Konservativen Enda Kenny verlangt niedrigere Zinsen, soll dafür aber eine Gegenleistung anbieten und seine Körperschaftsteuer anheben. In Portugal zeichnet sich unterdessen mit dem Rücktritt von Regierungschef Jose Socrates eine Verschärfung der Lage ab: Weil sein ehrgeiziges Sparpaket im Parlament durchfiel, dürfte den Ratingagenturen auf der Grundlage ihrer bisherigen Ankündigungen nichts anderes übrig bleiben, als das Rating des Landes herabzustufen. Damit steigen die Zinsbelastungen weiter an. Beobachter rechnen seit Monaten mit einer Flucht der Portugiesen unter den europäischen Rettungsschirm.
Punkt 2: Der "Krisenmechanismus" ESM
Bei ihrem Vorbereitungstreffen Anfang der Woche haben die EU-Finanzminister die Details des dauerhaften Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) ausgehandelt. Er soll ab 2013 in Kraft treten und ein effektives Kreditvolumen von 500 Mrd. Euro für hoch verschuldete Euro-Staaten vorhalten. Der Einsatz soll auf Notfälle beschränkt bleiben.
Wenn einem Opfer der Schuldenkrise nicht anders geholfen werden kann, soll der ESM auch Staatsanleihen der Länder aufkaufen dürfen und bei einer drohenden Staatspleite die privaten Gläubiger zum Forderungsverzicht zwingen können. Der ESM soll sich auf einen Kapitalstock von 80 Mrd. Euro stützen und daneben 620 Mrd. Euro an Garantien und abrufbarem Kapital umfassen.
Die gewaltige Summe ist notwendig, um dem Fonds am Kapitalmarkt ausreichend Gewicht zu verleihen. Aufgrund seiner schieren Größe dürfte er in den Genuss niedriger Kreditzinsen kommen. Damit kann er seine Schwungmasse zu Gunsten eines notleidenden Euro-Landes einsetzen. Deutschland will über den Zeitplan zur Einzahlung der 80 Mrd. Euro nachverhandeln. Der deutsche Anteil beträgt knapp 22 Mrd. Euro. Insgesamt haftet Deutschland für eine weitaus größere Summe.
Punkt 3: Der Pakt für den Euro
Beim Gipfel in Brüssel wollen die Euro-Staaten auch einen neuen Pakt zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit schließen. Dessen Ziel ist es, Schwächen bei der Wettbewerbsfähigkeit in einzelnen Ländern zu beheben, um Wachstum und Beschäftigung zu stärken und die Staatsschulden im Griff zu behalten.
Vorgesehen ist, dass sich die Euro-Länder in vier Bereichen einschneidende Reformen vornehmen: Arbeitsmarkt und Produktivität, tragbare Staatsschulden, Steuersystem und die Stabilität des Bankensektors. Jedem Land bleibt es selbst überlassen, wie es die in nationaler Kompetenz liegenden Ziele erreicht. Sanktionen gibt es nicht.
Die Euro-Staats- und Regierungschefs verpflichten sich persönlich zur Umsetzung. Erste Länder sollen beim Gipfel Selbstverpflichtungen präsentieren. Einige Nicht-Euro-Staaten werden sich dem Pakt anschließen. Es ist davon auszugehen, dass auch die Investoren am Kapitalmarkt sehr genau darauf sehen werden, welche Regierung mitzieht und zu welchen Ergebnissen das ambitionierte Vorhaben tatsächlich kommt.
Punkt 4: Wirtschaftsüberwachung
Hier wird es übersichtlich: Beim EU-Gipfel wollen sich die Staats- und Regierungschefs darüber abstimmen, wie der verschärfte Stabilitätspakt auf nationaler Ebene umgesetzt werden kann. Bis Juni sollen sowohl das Europäische Parlament, als auch alle EU-Mitgliedstaaten grünes Licht geben für die geplante Reform des Stabilitätspakts und das neue Verfahren zum Kampf gegen wirtschaftliche Ungleichgewichte. Der Pakt sieht vor, dass Sanktionen gegen Haushaltssünder früher als bisher verhängt werden können. Damit der Pakt seine Wirkung entfalten kann, sollen die finanziellen Konsequenzen einer solchen Maßnahme Sünder-Staaten empfindlich treffen.
Punkt 5: Bankenstresstests
Nach dem Willen der Gipfel-Teilnehmer sollen sich die EU-Staaten auf womöglich notwendige Rettungsaktionen für diejenigen Banken vorbereiten, die den anstehenden Stresstest im europäischen Finanzsektor nicht bestehen. Vor Bekanntgabe der Ergebnisse des Tests im Juni drängen die EU-Spitzenpolitiker auf Strategien zur Restrukturierung anfälliger Institute. Die Banken sollen möglichst viele Angaben veröffentlichen, auch zu ihrem Engagement in europäischen Staatsanleihen. Hier dürfte ein Hilfsantrag der Portugiesen für neuen Wirbel sorgen.
Abgesehen von allen aktuellen und latent gärenden Schuldensorgen und anderen Fragen der Wirtschaftspolitik muss sich der EU-Gipfel auch mit den Entwicklungen in den südlichen Nachbarstaaten Europas befassen, also vornehmlich mit dem Krieg in Libyen, sowie den Fortschritten der Demokratiebewegungen in Tunesien und Ägypten.
Am Rande der Tagung erwarten Beobachter außerdem noch eine EZB-Personalie: Der Europäische Rat wird voraussichtlich ein neues Mitglied im Direktorium der Europäischen Zentralbank ernennen.
Quelle: ntv.de, mit rts