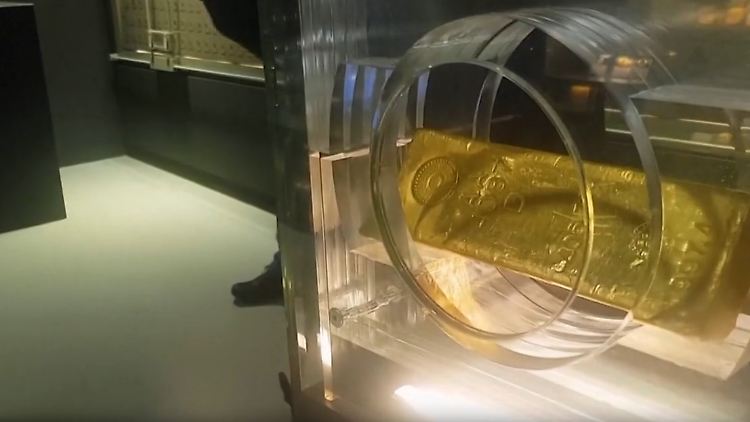Offene Rechnung mit Athen Siemens wartet auf Geld
08.12.2010, 10:00 UhrSiemens beklagt die mangelnde Zahlungsmoral griechischer Staatsunternehmen. Wegen offener Rechnungen greift der Konzern seiner griechische Landestochter mit rund 150 Millionen Euro finanziell unter die Arme. Griechische Privatunternehmen würden im Unterschied zu einigen staatlichen Stellen ihre Rechnungen begleichen, heißt es.

Siemens hat sich im Zuge der Korruptionsaffäre in Griechenland mit der Weltbank darauf geeinigt, 100 Mio. Dollar in Antikorruptions-Projekte zu stecken.
(Foto: picture-alliance/ dpa)
Der griechische Staat begleicht angesichts des anhaltenden Zwists über die Korruptionsaffäre einen Großteil seiner Rechnungen bei Siemens nicht. "Wir haben in Griechenland nicht unerhebliche ausstehende Forderungen", klagte Siemens-Vorstand Peter Solmssen.
"Die privaten Unternehmen zahlen, nur einige staatliche Stellen zahlen nicht." Die Rückstände, die Solmssen auf einen zweistelligen Millionenbetrag veranschlagte, brachten sogar die Landestochter des Konzerns ins Schwanken. "Wir haben 150 Mio. Euro frisches Kapital in das Geschäft gepumpt, um das Geschäft am Leben zu halten. Es wäre sonst unterkapitalisiert gewesen", sagte der Rechtsvorstand.
Konzernweit betrachtet hat Griechenland für Siemens kaum Bedeutung - der Jahresumsatz 2008/09 belief sich auf rund 250 Mio. Euro und machte weniger als ein Prozent des Gesamtumsatzes aus.
Kurruptionsaffäre in Griechenland
Die griechischen Behörden hadern allerdings immer noch mit den Folgen der Siemens-Korruptionsaffäre. Ein ehemaliger Minister wurde wegen Geldwäsche angeklagt, nachdem er die Annahme von Schmiergeldern in den 1990er Jahren eingeräumt hatte. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss geht dem Verdacht nach, ob Parteien und Politiker Bestechungsgelder bekommen haben.
Einem großen Teil der seinerzeit bei Siemens und bei den öffentlichen Auftraggebern Verantwortlichen werden die Hellenen allerdings nicht habhaft. So wehrte sich der ehemalige Landeschef des Unternehmens erfolgreich gegen seine Auslieferung nach Athen, der ehemalige Finanzchef der griechischen Tochter ist flüchtig. Zuletzt türmte auch noch der frühere Siemens-Konzernvorstand Volker Jung von der Ägäis-Insel Paros, wo er von den Behörden festgehalten worden war.
Vertrauensbildende Maßnahmen
Um sich ähnlichen Ärger künftig zu ersparen, startet Siemens eine weltweite Kampagne gegen Korruption. In einem ersten Schritt gibt der Konzern die erste Tranche von insgesamt 100 Mio. US-Dollar für die Schulung von Beamten und Managern sowie zur Unterstützung von Organisationen aus, die Bestechung bekämpfen. Dabei solle auch gegen Korruption rund um Olympische Spiele und Fußball-Weltmeisterschaften vorgegangen werden.
Der Münchener Konzern, der für den größten Korruptionsskandal der deutschen Nachkriegsgeschichte verantwortlich war, wolle "eine Koalition der Guten" schmieden, sagte Solmssen. Ganz freiwillig ist das Engagement allerdings nicht. "Das war Bestandteil der Auflagen der Weltbank", räumte der Manager ein. Sein Haus hatte die Initiative im Zuge der Aufarbeitung des Skandals zugesagt, um nicht für alle Ewigkeit von Aufträgen ausgeschlossen zu bleiben, die von der Weltbank mitfinanziert werden.
Solmssen macht in der Offensive allerdings auch eine positive Seite für künftige Siemens-Geschäft aus. "Wir verfolgen auch unsere Interessen damit. Aber wir können die Marktpraxis in vielen Ländern nicht alleine ändern."
Quelle: ntv.de, rts/DJ