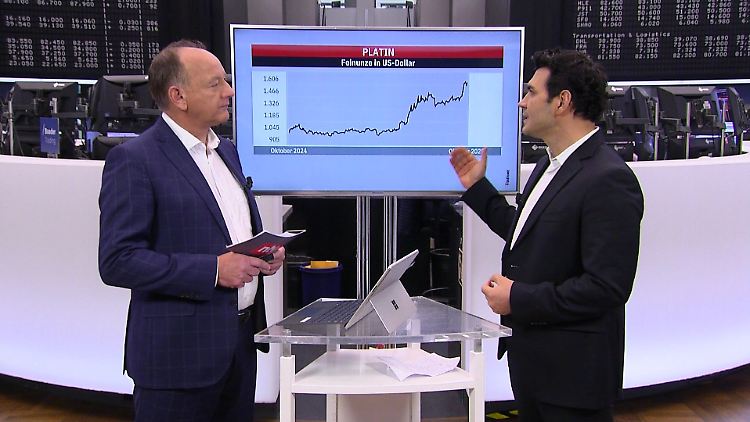"Netto-Skandal" ist keiner Löhne steigen leicht
24.09.2007, 06:40 UhrDas Bundesarbeitsministerium hat einen Bericht über einen angeblichen "Netto-Lohn-Skandal" entschieden zurückgewiesen. Die von der "Bild"-Zeitung verwendeten Daten, die im Übrigen nicht neu seien, würden von dem Blatt in unzulässiger Weise verkürzt wiedergegeben und "tendenziös interpretiert", teilte das Ministerium auf Nachfrage von n-tv.de mit. Der Eindruck, dass die Nettoverdienste der Arbeitnehmer im vergangenen Jahr auf dem Stand von vor 20 Jahren lägen und der Staat den Bürgern immer tiefer in die Tasche greife, sei falsch.
Insbesondere könnten die Zahlen vor der Wiedervereinigung praktisch nicht mit denen ab 1986 verglichen werden, hieß es. Denn die Situation Gesamtdeutschlands sei nicht mit der der alten Bundesrepublik vergleichbar. Die Ursache für die Lohnentwicklung liege zudem bei den Unternehmen, nicht beim Staat.
Realeinkommen sinkt, Stundenlöhne steigen
Tatsächlich ist das durchschnittliche Realeinkommen - also der Bruttoverdienst der Arbeitnehmer abzüglich Steuern, Sozialversicherungsbeiträgen und unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerung - in den letzten beiden Jahren gesunken: 2005 um 1,6 Prozent, 2006 um 1,9 Prozent. Betrug das durchschnittliche Nettorealeinkommen 2004 16.428 Euro, waren es 2006 noch 15.845 Euro. Dies ist zugleich der niedrigste Wert seit der Wiedervereinigung.
"Allerdings fließen in die Statistik auch die Gehälter und Löhne von Teilzeitkräften und geringfügig Beschäftigten mit ein", erklärte Jens Grütz vom Statistischen Bundesamt gegenüber n-tv.de. Arbeiten mehr Menschen in Teilzeit, sinkt das durchschnittliche Nettorealeinkommen. Und offenbar gibt es einen Trend zur Teilzeit: 2004 arbeiteten 22 Prozent alles Erwerbstätigen in einem Teilzeit-Modell. 1996 waren es erst 17 Prozent gewesen. Eine Sprecherin des Bundesarbeitsministeriums bestätigte, dass das durchschnittliche Nettorealeinkommen nicht verwechselt werden dürfe mit dem durchschnittlichen Verdienst eines in Vollzeit Beschäftigten. Wie viele Teilzeitkräfte konkret in die Statistik des Statistischen Taschenbuchs des Bundesarbeitsministeriums eingerechnet sind, konnte das Ministerium nicht sagen.
Schaut man auf einen durchschnittlichen Arbeitnehmer in Vollzeit ergibt sich darum ein anderes Bild. So stieg das Nettorealeinkommen eines alleinstehenden Arbeiters (alte Bundesländer) von 1991 bis 2006 um 3 Prozent. Bei einem angestellten Familienvater mit Kindern waren es 14 Prozent. Der durchschnittliche Netto-Realstundenlohn, also abzüglich Steuern und Sozialabgaben und um die Inflation bereinigt, stieg von 11,08 Euro im Jahr 1991 auf 11,76 Euro im Jahr 2006, was einem Anstieg von 6,2 Prozent entspricht.
Abzüge steigen auf Rekordsumme
Die durchschnittlichen Abzüge vom Bruttogehalt pro abhängig Beschäftigten lagen im vergangenen Jahr zugleich so hoch wie noch nie: Sie betrugen 9291 Euro. Das sind rund 270 Euro mehr als noch 2005, über 3000 Euro mehr als 1991. Dabei geht die Steuerlast in den vergangenen zehn Jahren tendenziell zurück, die Abgaben für Renten- und Krankenversicherung steigen kontinuierlich.
Schuld sind die Arbeitgeber
Die Nettoquote, also der Anteil des Bruttogehalts, der nach sämtlichen Abzügen übrig bleibt, betrug 2006 65,2 Prozent. Laut Statistik pendelt die Nettoquote seit 1995 um diesen Wert. "Der Staat hat also seit zehn Jahren nicht stärker zugegriffen", erklärte das Arbeitsministerium. Zum Vergleich: Vor 50 Jahren lag die Nettoquote noch bei 85,5 Prozent.
Schuld am sinkenden Nettorealeinkommen sind darum laut Bundesarbeitsministerium vor allem die zu niedrigen Lohnabschlüsse. Zwar seien die Löhne in den vergangenen zehn Jahren gestiegen, allerdings langsam, so dass die Lohnsteigerung hinter der Preisentwicklung zurückblieb.
Grünen-Chef Reinhard Bütikofer nahm bei n-tv darum die Unternehmen in die Pflicht. "Ich glaube, dass man zunächst einmal, wenn über die Frage der Lohnhöhe diskutiert wird, nicht auf den Staat gucken muss, sondern auf die Arbeitgeber." Es habe in verschiedenen Branchen drastische Lohnsenkungen gegeben und "deswegen sind wir für Mindestlohnregelegungen". Niedrige Löhne müssten von den Lohnnebenkosten entlastet werden, sagte Bütikofer. Dies wäre eine wirksame Maßnahme.
"Armutslöhne"
FDP-Generalsekretär Dirk Niebel prangerte dagegen das seiner Ansicht nach "dreiste Zugreifen" des Staates an. Nettolöhne hätten in erster Linie etwas mit den Abgaben und mit den Steuern zu tun, sagte er bei n-tv. Er forderte ein Herangehen an die Sozialversicherungsbeiträge. "Hier haben wir bei der Arbeitslosenversicherung schon seit über einem Jahr einen deutlichen Beitragssenkungsspielraum auf mindesten 3,5 Prozent."
Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Michael Sommer, sagte: "Es gibt dringenden Nachholbedarf für den 'kleinen Mann'" Die Geldbeutel der Menschen seien in den vergangenen Jahren geschröpft worden, und die Lohnsteigerungen mager ausgefallen. Seit Jahren hätten die Arbeitgeber Lohnverzicht gepredigt und Armutslöhne gezahlt. "Hauptsache billig - das scheint das Credo vieler Unternehmer zu sein", kritisierte Sommer. Er forderte einen vernünftigen Anstieg der Bruttolöhne, damit die Menschen einen "gerechten Anteil am erwirtschafteten Einkommen bekommen". Sommer bekräftigte die Forderung nach einem gesetzlichen Mindestlohn von mindestens 7,50 Euro pro Stunde.
Quelle: ntv.de