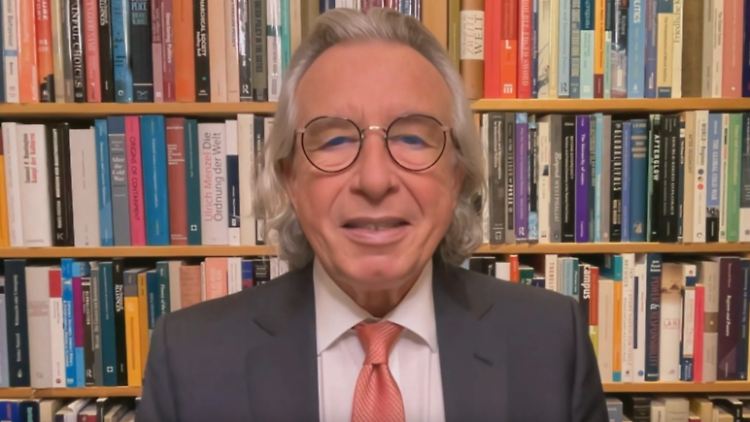EU-Kommission verteidigt Schritt Arbeitsmarkt für Rumänen und Bulgaren offen
01.01.2014, 10:49 Uhr
Rumänische Helfer gehörten schon bisher zum Bild bei der Spargelernte in Deutschland.
(Foto: dpa)
Mit dem neuen Jahr können Bulgaren und Rumänen in der EU ohne Einschränkung nach Arbeit suchen. Die CSU warnt vor einer Zuwanderungswelle. Die EU-Kommission weist diese Befürchtungen zurück und betont die Chancen, die in der Arbeitnehmerfreizügigkeit liegen.
Seit Mitternacht steht Rumänen und Bulgaren der deutsche Arbeitsmarkt offen. Die Bürger der beiden EU-Länder genießen mit dem 1. Januar das uneingeschränkte Recht, in allen EU-Staaten einen Job zu suchen. Eine Arbeitserlaubnis ist nicht mehr nötig, um ins Land kommen zu können. Erwartet werden in Deutschland nach jüngsten Prognosen bis zu 180.000 Zuwanderer.
Rumänien und Bulgarien sind die ärmsten Länder innerhalb der EU. Bei ihrem Beitritt 2007 hatten sie akzeptiert, dass die EU-weite Freizügigkeit für eigene Staatsbürger erst mit sieben Jahren Verspätung gilt.
Die neue Arbeitnehmerfreizügigkeit hat in Deutschland einen heftigen politischen Streit ausgelöst. Die CSU warnt vor einer sogenannten "Armutszuwanderung" - Migration von Menschen mit dem Ziel, ihrer wirtschaftlichen Misere zu entkommen und dabei vom deutschen Sozialsystem zu profitieren. Sie will Ausländern daher den Zugang zu Sozialleistungen erschweren - etwa durch eine dreimonatige Sperrfrist für Hartz-IV-Hilfen an Zuwanderer. SPD und Opposition warfen der CSU Populismus vor.
Andor: Grenzen dicht machen ist keine Lösungg
Bulgariens Botschafter in Berlin, Radi Naidenov, kritisierte die deutsche Debatte. "Wer Vorurteile bedient und populistisch argumentiert, schadet der europäischen Idee insgesamt und damit uns allen", sagte Naidenov der "Welt".
Die EU-Kommission verteidigte den Fall der letzten Job-Schranken. "Ich bin fest davon überzeugt, dass ein Beschränken der Freizügigkeit von europäischen Beschäftigten nicht die Antwort auf hohe Arbeitslosigkeit oder eine Lösung der (Wirtschafts-)Krise ist", sagte EU-Sozialkommissar Laszlo Andor.
Da schon über drei Millionen Bulgaren und Rumänen in anderen EU-Staaten leben, rechnet der aus Ungarn stammende Andor nicht mit einer dramatischen Zuwanderungswelle. Die Kommission erkenne aber an, dass es auf lokaler oder regionaler Ebene Probleme geben könnte, falls Menschen vermehrt zuwanderten. "Die Lösung ist, diese spezifischen Probleme anzugehen, und nicht Wälle gegen diese Beschäftigten aufzurichten", argumentierte Andor.
Für Kroatien gelten Beschränkungen weiter
Mitgliedstaaten könnten in solchen Fällen den europäischen Sozialfonds in Anspruch nehmen, der jährlich mit über zehn Milliarden Euro ausgestattet sei. Jedes Land sollte von nun an jeweils mindestens ein Fünftel der Gelder aus diesem Topf ausgeben, um Armut zu bekämpfen und soziale Integration voranzubringen.
Der Bundesverband der Deutschen Industrie nutzt die Debatte für einen allgemeinen Appell: Deutschland müsse generell für Zuwanderer attraktiver werden, sagte Verbandspräsident Ulrich Grillo. Denn bis 2020 sinke das Potenzial an Erwerbstätigen um 6,5 Millionen Menschen. "Wenn wir stärker wachsen wollen, müssen wir auch qualifizierte Arbeitskräfte aus dem Ausland hereinholen. Und diese Menschen müssen die Möglichkeit bekommen, integriert zu werden." Die Attraktivität Deutschlands zu steigern, habe nicht nur mit Geld zu tun.
Die neuen Regelungen vom 1. Januar 2014 an sind ein weiterer Schritt zur vollständigen Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb der Europäischen Union. Für Bürger aus dem neuen Mitgliedsland Kroatien gelten allerdings in Deutschland und einigen anderen EU-Staaten weiterhin Beschränkungen - möglicherweise bis zum Jahr 2020. Das Recht auf Arbeitnehmerfreizügigkeit ist Teil der vier Grundfreiheiten für Personen, für Waren und Dienstleistungen sowie für den Kapital- und Zahlungsverkehr.
Um Verwerfungen am Arbeitsmarkt durch zuwandernde Niedriglöhner zu verhindern, hatten Deutschland und Österreich dieses Recht für Bürger der osteuropäischen Beitrittsländer zunächst eingeschränkt. Am 1. Mai 2011 endeten diese Übergangsregelungen für die mittelosteuropäischen EU-Staaten Polen, Tschechien, Slowakei, Slowenien, Ungarn, Lettland, Litauen, und Estland. Für Rumänien und Bulgarien galten sie weiter. Das Bundesarbeitsministerium hatte in einer Antwort auf eine Anfrage der Linksfraktion berichtet, dass mit Blick auf die Erfahrungen von 2011 keine besonderen Risiken von der Öffnung des Arbeitsmarkts für Bulgaren und Rumänen ausgehen.
Quelle: ntv.de, jog/dpa