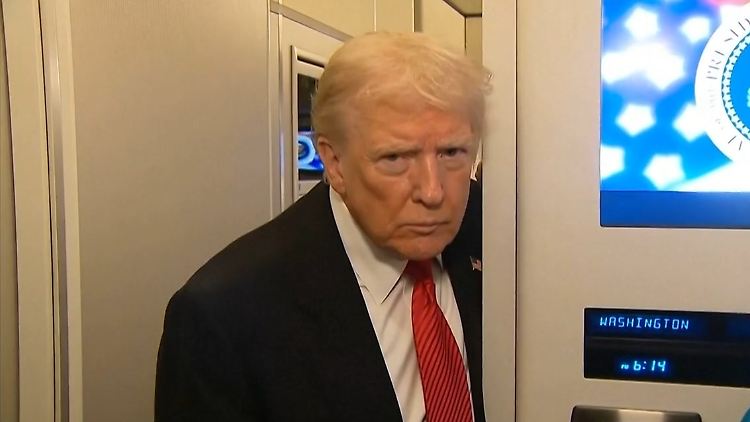Strahlende Zukunft Bundestag entscheidet über Laufzeiten
28.10.2010, 07:56 Uhr
Hinter den Kühltürmen des Atomkraftwerks Grafenrheinfeld in Unterfranken geht die Sonne unter.
(Foto: dpa)
Trotz massiver Kritik von Opposition, Kommunen und Experten will der Bundestag heute den Weg für die Verlängerung der Laufzeiten der 17 deutschen Atomkraftwerke um 8 bis 14 Jahre frei machen. Parallel starten etwa 50 kommunale Energieversorger eine Kampagne gegen das Gesetz. Ein Gutachten zeigt, dass die Bundesregierung bei den Nachrüstkosten für die AKW-Sicherheit entgegen ihrer Behauptung doch spart.
Entgegen ihrer Ankündigungen schafft die schwarz-gelbe Koalition einem Gutachten zufolge weniger Sicherheit bei den 17 deutschen Atomkraftwerken. Von den ursprünglich vorgesehenen 50 Milliarden Euro für das Nachrüstungsprogramm sei nach dem Vertrag der Bundesregierung mit den Energieversorgungsunternehmen nur eine halbe Milliarde für jede Anlage übrig geblieben, heißt es in dem Gutachten für die Grünen-Fraktion. Es wurde vom langjährigen Abteilungsleiter für Reaktorsicherheit im Umweltministerium, Wolfgang Renneberg, erstellt. Auf einen Schutz gegen Flugzeugabstürze sei ganz verzichtet worden.
Die Regierung hatte wiederholt betont, dass an der Sicherheit nicht gespart werde. Auch seien die Nachrüstkosten von 500 Millionen Euro pro Atomkraftwerk nur ein Richtwert, natürlich seien auch höhere Kosten möglich, wenn dies erforderlich sei. Heute will der Bundestag die im Schnitt 12 Jahre längeren Atomlaufzeiten beschließen. Auch die Sicherheitsregeln werden dann verabschiedet. Vor dem Reichstag haben Umweltgruppen Proteste angekündigt.
Anwohnerrechte werden ausgehebelt

Das Wendland protestiert gegen den Transport von Atommüll, der am ersten Novemberwochenende wieder nach Deutschland rollen soll.
(Foto: dapd)
Das Gutachten kritisiert, dass die Nachrüstungsliste von Umweltminister Norbert Röttgen (CDU) keine konkreten Maßnahmen zu den einzelnen Anlagen enthalte. Es sei nicht erkennbar, welche Anlage betroffen sei und welche nicht.
Besonders wird der neue Paragraf 7d im Atomgesetz kritisiert, der laut Röttgen ein Mehr an Sicherheit schafft und die Vorsorgepflicht der AKW-Betreiber erweitert. Das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass es die von Röttgen erwähnte "dynamische Schadensvorsorge" seit 50 Jahren im Atomgesetz gebe, deshalb sei der Paragraf 7d überflüssig.
Dessen Zweck sei vielmehr, das bisher einklagbare Recht von AKW-Anwohnern auf Nachrüstungen, wie einen Schutz vor Flugzeugabstürzen, auszuhebeln. Die genannte Grundvorsorge enthalte nicht mehr das, worauf es dem Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil 2008 angekommen sei, nämlich dass ein Angriff auf Atomkraftwerke nicht mehr dem von den Bürgern zu duldenden Restrisiko zuzurechnen ist.
Bundesrat wird nicht gefragt
Union und FDP wollen die Betriebszeit der vor 1980 gebauten 7 Anlagen um 8 Jahre verlängern, die der 10 übrigen AKW um 14 Jahre. Trotz mindestens fünf Abweichlern im Unionslager gilt eine Mehrheit der schwarz-gelben Koalition bei der Abstimmung im Parlament als sicher. Da Union und FDP wegen fehlender Mehrheit im Bundesrat das Gesetz ohne Zustimmung der Länderkammer in Kraft setzen wollen, haben SPD, Grüne und Linke Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht angekündigt. Wegen aus ihrer Sicht unzureichender Beratungszeit hatte die Opposition zudem ein Vertagen der Schlussdebatte im Bundestag gefordert. Im federführenden Umweltausschuss war es deshalb tags zuvor zu einem Eklat gekommen.
Ausstieg vom Ausstieg
SPD und Grüne hatten vor zehn Jahren einen Atomausstieg bis etwa 2022 beschlossen, der nun aufgekündigt werden soll. Die Vize-Fraktionschefin der Grünen, Bärbel Höhn, ist sich sicher, dass das neue Atomgesetz einen Regierungswechsel nicht überstehen wird. "Die Atomfrage wird im nächsten Wahlkampf eine große Rolle spielen und wir werden alles daran setzen, an der nächsten Bundesregierung beteiligt zu sein", sagte Höhn der "Frankfurter Rundschau". Spätestens dann werde die Laufzeitverlängerung wieder kassiert werden.

Während der Abstimmung im Parlament wollen Umweltgruppen erneut vor dem Reichstagsgebäude demonstrieren.
(Foto: dapd)
Da die Stromkonzerne den Atomkonsens von 2000 gebrochen hätten, könnten sie sich nach einem Regierungswechsel nicht mehr auf einen Vertrauensschutz hinsichtlich der schwarz-gelben Verlängerung berufen, sagte Höhn. Entschädigungsforderungen sind nicht zu befürchten, weil die Zusatz-Laufzeiten nicht vom Eigentumsgrundrecht geschützt würden. Eine Regierung mit grüner Beteiligung werde die Brennelemente-Steuer zudem so erhöhen, dass ein Weiterbetrieb der Atomkraftwerke unrentabel werde.
Im Zusammenhang mit der Laufzeit-Entscheidung berät das Parlament auch über das Energiekonzept der Bundesregierung. So sollen bis 2050 alle 18 Millionen Gebäude auf moderne Energie- und Klimastandards gebracht werden. Diskutiert werden auch Vorlagen, mit denen Zusatzgewinne der AKW-Betreiber aufgrund der längeren Laufzeiten teilweise abgeschöpft werden sollen. Dazu zählt eine Steuer auf Kernbrennstoffe.
Kommunale Versorger bleiben auf der Strecke
Parallel zur Abstimmung im Bundestag über die AKW-Laufzeitverlängerung starten rund 50 kommunale Energieversorger eine Kampagne gegen das Gesetz. Bei den Stadtwerken seien Investitionen von sechs Milliarden Euro gefährdet, sagte Thüringens Wirtschaftsminister Matthias Machnig der "Thüringer Allgemeine" zur Begründung. Zudem werde das Angebotsoligopol der vier großen Stromkonzerne gefestigt und die Innovationsdynamik bei erneuerbaren Energien werde ausgebremst.
Atomkraft – im Herzen grün?
Dagegen sieht der Chef des drittgrößten Energieversorgers EnBW, Hans-Peter Villis, die Atomkraft als Wegbereiter für den Übergang zu erneuerbaren Energien. "In Deutschland brauchen wir noch Zeit, um die erneuerbaren Energien in die Wirtschaftlichkeit zu bringen", behauptet Villis. "Hierfür benötigen wir unter anderem die Kernkraft." Außerdem würden die "in der Erzeugung praktisch CO2-freien Kernkraftwerke bei der Erreichung der nationalen Klimaziele" helfen.
Quelle: ntv.de, hdr/dpa/rts/AFP