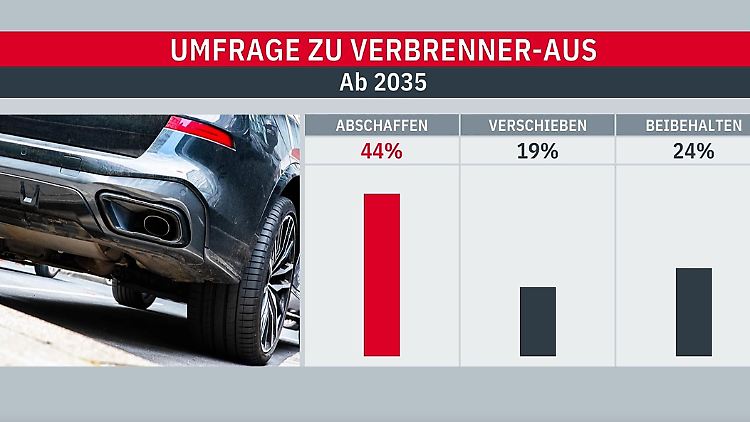Schweden wählt neues Parlament Das Volksheim verfällt
13.09.2014, 11:04 Uhr
Wird Fredrik Reinfeldt (rechts) von Stefan Löfven abgelöst?
(Foto: AP)
Seit acht Jahren regiert Fredrik Reinfeldts bürgerliche Allianz in Schweden. Doch nun könnten die Sozialdemokraten die Regierungsgeschäfte wieder übernehmen. So oder so: Schweden ist nicht mehr das soziale Vorzeigeland, das es einmal war.
Auf den letzten Metern ist es doch spannend geworden: Eine kürzlich von der Zeitung "Aftonbladet" veröffentlichte Umfrage sorgte noch einmal für ein Aufleben des bis dahin lahmen Wahlkampfes in Schweden. Für die regierende bürgerliche Koalition von Ministerpräsident Fredrik Reinfeldt werden gut 40 Prozent veranschlagt. Der lange Zeit klar führende Oppositionsblock aus Sozialdemokraten, Grünen und Linkspartei weist nur noch etwas mehr als 44 Prozent auf. Im größten skandinavischen Land wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt.
Reinfeldt hatte sich eigentlich schon seinem Schicksal ergeben, entsprechend lustlos präsentierte sich der seit 2006 amtierende Regierungschef lange Zeit im Wahlkampf. Seine konservative Moderate Sammlungspartei dümpelte bei knapp über 21 Prozent herum, während die Sozialdemokraten seines politischen Gegenspielers Stefan Löfven klar über der 30-Prozent-Marke lagen. Zwei kleinere Koalitionspartner Reinfeldts, die Christdemokraten und die Zentrumpartei, kämpften mit der für den Einzug in den Stockholmer Reichstag notwendigen Vier-Prozent-Hürde. Zu weit weg schienen die Oppositionsparteien, die Übernahme des Ministerpräsidenten-Amtes durch Löfven bereits ausgemachte Sache. Doch der ehemalige Gewerkschaftsfunktionär muss nun bangen.
Und der 57-Jährige ist nicht ganz schuldlos an der entstandenen Situation. Zu Wochenbeginn unterlief ihm ein Fehler, als er Roma im schwedischen Rundfunk als Zigeuner bezeichnete. Er entschuldigte sich zwar schnell, aber der sozialdemokratische Wahlkampf wurde dadurch dennoch gestört. Noch schlimmer: Löfven geriet in eine von ihm nicht gewollte Nähe mit den rechtspopulistischen Schwedendemokraten von Jimmie Åkesson, die mit fremdenfeindlichen Parolen durch das Land ziehen und damit auch punkten.
Großes Problem Jugendarbeitslosigkeit
In Schweden steht die liberale Einwanderungspolitik auf dem Prüfstand. Die Ausschreitungen vom Mai 2013 im Stockholmer Vorort Husby haben das Königreich aufgeschreckt. Der Tod eines offenbar geistig verwirrten Einwanderers, den die Polizei nach eigenen Angaben aus Notwehr erschoss, sorgte tagelang für Unruhen. Sie lenkten die Aufmerksamkeit auch auf ein großes Problem: die hohe Jugendarbeitslosigkeit, von der vor allem junge Menschen mit Migrationshintergrund betroffen sind. Insgesamt sind in Schweden rund 22 Prozent im Alter von 15 bis 24 Jahren ohne Job; in Deutschland sind es derzeit 7,8 Prozent. Die Schwedendemokraten und rechtsradikale Gruppen in ihrem Dunstkreis fordern vehement eine rigide Einwanderungspolitik. Reinfeldt, der befürchtet, Wähler seiner "Moderaterna" an die Åkesson-Truppe zu verlieren, deutete ein Überdenken der bisherigen Migrantenpolitik an.
Die Einwanderer-Problematik ist aber nur ein Glied der immer länger werdenden schwedischen Problemkette, die mit dem langsamen Verschwinden des Wohlfahrtsstaates - in Schweden ursprünglich auch Folkhemmet (Volksheim) genannt - zu tun hat. Diesen Staat, der in den 1970er Jahren seine stärkste Ausprägung erfuhr, gibt es in dieser Form nicht mehr. Dabei war das Modell, das keine Privilegierten und keine Benachteiligten kennt, den Abbau aller ökonomischen und sozialen Schranken als Ziel ausgibt und den Starken verbietet, die Schwachen zu unterdrücken, lange Zeit das große Vorbild für andere Gesellschaften. Aber die 1986 ermordete Ikone der schwedischen Sozialdemokratie, Olof Palme, hatte bereits schon früh erkannt, dass der Wohlfahrtsstaat großen Gefahren ausgesetzt ist. "Die Wirklichkeit ist unser größter Widersacher", sagte der ehemalige Ministerpräsident.
Demontage des Wohlfahrtsstaates
Nun ist das Dach des schwedischen Volksheims undicht, sein Mauerwerk weist Risse auf. Daran ist die derzeitige bürgerliche Regierung nicht alleine schuld. Der Verfall begann viel früher: Es war die Anfang der 1990er Jahre grassierende nationale Finanzkrise, die Schweden zwang, sein Bankensystem radikal umzukrempeln. Die Krise entwickelte und entlud sich unter der sozialdemokratischen Regierung von Ingvar Carlsson. Der Konservative Carl Bildt, der Carlsson 1991 als Ministerpräsident beerbte, war zu weitreichenden Reformen gezwungen. Er brauchte Geld für die Bankenrettung und kürzte Sozialleistungen, sparte im Bildungssystem und koppelte das Rentensystem an die ökonomische Entwicklung. Die Schweden waren sauer und beorderten 1994 Carlsson und seine Sozialdemokraten zurück in die Regierung. Doch auch die Roten konnten die Wirklichkeit nicht ignorieren. Ihr von 1996 bis 2006 amtierender Regierungschef Göran Persson demontierte den Wohlfahrtsstaat weiter. Nur noch in einem Sozialbereich, dem Elternschaftsurlaub, hatte Schweden gegenüber den meisten EU-Partnern noch einen deutlichen Vorsprung. Aber Schweden stand wirtschaftlich gut da. Der hohe Preis: eine wachsende Ungleichheit in der schwedischen Gesellschaft.
Heute liegen Reinfeldts Moderate und Löfvens Sozialdemokraten in vielen Fragen gar nicht weit auseinander. Beide große Parteien sehen die Notwendigkeit der Schaffung Hunderttausender neuer Jobs - Schweden hat derzeit eine für das Land hohe Arbeitslosenquote von acht Prozent. Beide sprechen sich gegen Steuersenkungen aus. Sowohl Reinfeldt als auch Löfven wollen den Sozialstaat - so jedenfalls sagten sie es im Wahlkampf - nicht weiter schröpfen. Der große Unterschied: Die Sozialdemokraten wollen die unter Reinfeldt vorgenommene Privatisierung von Dienstleistungsbetrieben rückgängig machen. Löfven hat dabei die kommunale Gesundheits- und Altersvorsorge im Blick.
Der finanzielle Spielraum ist dabei auch für eine etwaige Mitte-links-Regierung gering. Denn in Schweden gibt es zwischen den seriösen politischen Gruppierungen einen Konsens, der besagt, dass in wirtschaftlichen Boomjahren der Staatshaushalt einen Überschuss zu erwirtschaften hat. Reinfeldt hat sich während der weltweiten Finanzkrise 2008/09 daran gehalten und auf eine Kurzarbeitsregelung verzichtet. Der Regierungschef nahm stattdessen einen Anstieg der Arbeitslosenquote in Kauf. Zugleich kürzte er im Bildungsbereich.
In diese Kerbe schlagen nun die fremdenfeindlichen Schwedendemokraten. "Wir wählen die Wohlfahrt", ist ihr Wahlslogan. Neue Pflegeplätze, die Erhöhung des Arbeitslosengeldes, die Abschaffung der Arbeitgeberabgabe für kleine Unternehmen fordern die Rechtspopulisten. Parteichef Åkesson spricht von umgerechnet 38 Milliarden Euro, die dafür in den nächsten vier Jahren zur Verfügung stünden. Die Losungen der Rechten scheinen zu verfangen, laut Umfragen könnten sie ein zweistelliges Ergebnis einfahren.
Minderheitsregierungen haben Tradition
Rot-Grün-Rot oder bürgerliche Allianz: Derzeit stehen die Zeichen auf Ersteres. Dabei existieren auch zwischen Sozialdemokraten, Grünen und Linkspartei Spannungen. So fordern die Grünen die Schließung von zwei Atomreaktoren, bei Löfven steht der Atomausstieg nicht ganz oben auf der Agenda. Linkspartei-Chef Jonas Sjöstedt will seinerseits keine weiteren sozialen Abstriche zulassen. Weil in Schweden Minderheitsregierungen Tradition haben, ist es möglich, dass Sozialdemokraten und Grüne eine Regierung bilden, die von der Linkspartei unterstützt wird. Diese Variante gilt auch in der schwedischen Presselandschaft als die wahrscheinlichste, zumal Sozialdemokraten, Grüne und Linkspartei diesmal nicht als Wahlbündnis aufgetreten sind. Eine Kooperation Löfvens mit Parteien aus der derzeit regierenden Koalition ist eher unwahrscheinlich, obwohl der Sozialdemokrat Bereitschaft zur Zusammenarbeit signalisiert hat. Es wäre auch das erste Mal seit 1951, dass die Sozialdemokraten mit einer Partei des bürgerlichen Lagers die Regierung bilden würden.
Reinfeldts Allianz will im Falle eines schlechteren Wahlergebnisses keine neue Minderheitsregierung bilden. Den Tabubruch einer Zusammenarbeit mit den Schwedendemokraten lehnt der Ministerpräsident ab. Somit ist die Wahrscheinlichkeit eines Regierungswechsels sehr groß - trotz der jüngsten Umfragen.
Nach der Wahl beginne das eigentliche Drama, schreibt die liberale Zeitung "Dagens Nyheter". Sie weist damit auf ein typisch schwedisches Dilemma hin, die Unbeweglichkeit der beiden politischen Blöcke. Die anstehende Regierungsbildung könnte die komplizierteste seit langer Zeit werden. Sicher ist: Die Schweden werden es ihrer politischen Klasse in dieser Hinsicht nicht leicht machen.
Quelle: ntv.de