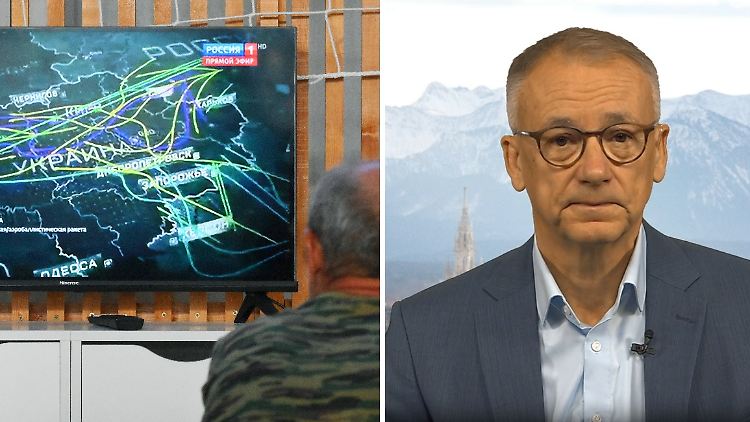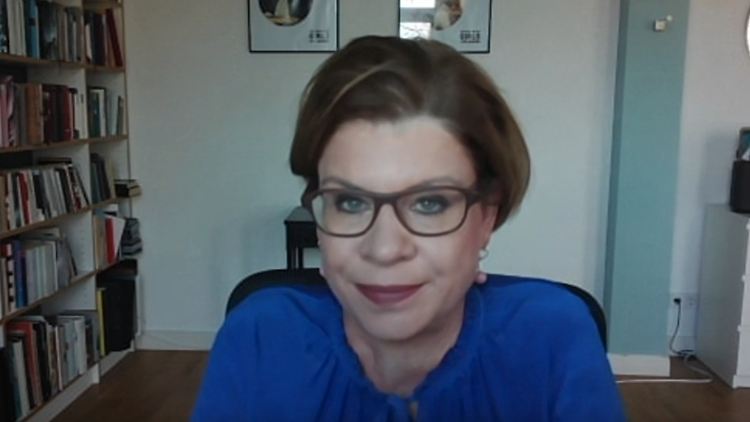Massaker an 21.000 Polen in Katyn EU: Russland "unmenschlich"
16.04.2012, 15:44 Uhr
Ein Mahnmal erinnert auf dem Militärfriedhof von Katyn an das Massaker.
(Foto: dpa)
Zehntausende Polen erschießt der russische Geheimdienst im Jahr 1940 in Katyn, wirft die Leichen in Massengräber, gibt den deutschen Nationalsozialisten die Schuld und hält alle Dokumente zurück. Die Hinterbliebenen der Opfer ziehen vor den Europäischen Gerichtshof. Die Richter rügen Russland, lehnen neue Ermittlungen aber ab.
Mehr als sieben Jahrzehnte nach den Massakern an mehreren tausend Polen nahe Katyn, darunter auch polnische Offiziere, haben zehn Hinterbliebene einen Sieg vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte errungen. Die Straßburger Richter rügten die Weigerung Russlands, die Angehörigen über die Verbrechen aufzuklären und ihnen Einsicht in die Ermittlungsakten zu gewähren. Auch dem Gerichtshof habe Moskau die als vertraulich eingestuften Akten vorenthalten.
Der russische Staat reagierte mit Erleichterung auf das Urteil. Dass der Kernpunkt einer Neuaufnahme der Ermittlungen zu dem Kriegsverbrechen von den Straßburger Richtern abgelehnt worden sei, werde als "gutes Ergebnis" gewertet, sagte der Jurist Andrej Fjodorow vom russischen Justizministerium. Die Führung in Moskau werde vermutlich keine Berufung gegen das Urteil einlegen, sagte Fjodorow.
Befehl Stalins
Die russische Menschenrechtsorganisation Memorial, die sich vor allem auch der Aufarbeitung von historischem Unrecht verschrieben hat, begrüßte den Straßburger Richterspruch. Damit gebe es die Chance, dass das Massaker weiter aufgeklärt werde.
Geklagt hatten insgesamt 15 Angehörige von elf polnischen Offizieren und einem Schuldirektor. Sie gehörten zu den mehr als 21.000 Polen, die im April und Mai 1940 auf Befehl des Sowjetdiktators Josef Stalin in der Gegend von Smolensk von der russischen Geheimpolizei in Lager getrieben, erschossen und anschließend im Wald von Katyn in Massengräber geworfen wurden.
Moskau hatte jahrzehntelang die Verantwortung für diese Kriegsverbrechen bestritten und dafür die Nationalsozialisten verantwortlich gemacht. Erst im Jahr 1990 leitete Russland Ermittlungen ein, die 2004 ohne Ergebnis zu den Akten gelegt wurden. Die Staatsduma erkannte erstmals im Jahr 2010 an, dass Stalin für die Massentötungen verantwortlich war.
Keine Akteneinsicht
Die Kläger hatten jahrelang versucht, von Russland Auskunft über die Umstände zu erhalten, unter denen ihre Verwandten getötet wurden. Ihre Anträge, Einsicht in die Ermittlungsakten Akten zu bekommen, wurden von russischen Gerichten abgewiesen. Auch die Entscheidung von 2004 zur Einstellung des Verfahrens durften die Angehörigen nicht einsehen. Die russische Justiz begründete dies mit der Vertraulichkeit der Unterlagen, die als geheim eingestuft wurden.
Dieses Verhalten wertete der Straßburger Gerichtshof als "unmenschlich". Die russischen Behörden hätten den Hinterbliebenen der Opfer nicht bei der Suche nach der Wahrheit geholfen und auch keine "ernsthafte Anstrengungen" unternommen, um die Massengräber zu lokalisieren. Im Übrigen sei die Weigerung Russlands, die Realität des Kriegsverbrechens von Katyn einzugestehen, "frappierend", heißt es in dem Urteil.
Im Falle von zehn Klägern sei damit gegen das Verbot unmenschlicher Behandlung in Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention verstoßen worden, befand das Gericht. Bei dieser Gruppe handelt es sich um eine Witwe sowie Kinder und Enkelkinder von Opfern. Die Beschwerde der fünf anderen Kläger, die niemals enge Kontakte zu einem der Opfer hatten, wies der Gerichtshof hingegen ab.
Verstoß gegen Menschenrechtskonvention
Die Straßburger Richter kritisierten zudem scharf, dass Moskau auch dem Gerichtshof für Menschenrechte Einsicht in die Ermittlungsunterlagen verweigerte. Das Argument, russische Gesetze verböten die Übermittlung vertraulicher Dokumente, stehe in Widerspruch zur Wiener Konvention, wonach ein Staat nicht unter Berufung auf nationales Recht internationale Verträge verletzen darf.
Außerdem habe Moskau damit gegen Artikel 38 der Menschenrechtskonvention verstoßen, heißt es in dem Urteil. Über diesen Artikel, der die Unterzeichnerstaaten zur Zusammenarbeit mit dem Gerichtshof für Menschenrechte verpflichtet, hatte sich Russland bereits in zahlreichen anderen Verfahren hinweggesetzt. Gegen das nun gefällte Urteil können beide Parteien binnen drei Monaten Rechtsmittel einlegen.
Quelle: ntv.de, AFP/dpa