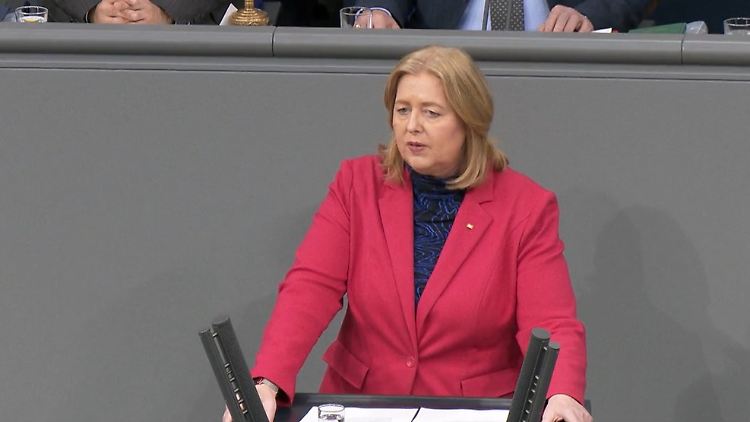Totgeburten und Nasenbluten Fukushima ist nicht überstanden
12.03.2012, 11:02 Uhr
In die Sperrzone kann wohl niemand mehr zurückkehren.
(Foto: REUTERS)
Viele Japaner haben nach dem Super-Gau in Fukushima Angst vor der Strahlung, und sie haben allen Grund dazu. Es gebe deutliche Parallelen zu den Vorgängen nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, sagt der Präsident der Gesellschaft für Strahlenschutz, Pflugbeil, n-tv.de. Die Symptome für die Verstrahlung der Menschen seien unübersehbar.
Die radioaktive Verseuchung durch die AKW-Katastrophe in Japan wird "dauerhaft und langjährig" sein. Zu diesem Schluss kamen gerade französische Experten. Ihre Studie beruht auf Untersuchungen, die Experten des französischen Strahlenschutzamtes IRSN vor Ort vorgenommen haben, sowie auf offiziellen Angaben der japanischen Regierung.
Sebastian Pflugbeil, der Präsident der Gesellschaft für Strahlenschutz, ist gerade von einem Besuch in Japan zurückgekehrt. Seiner Ansicht nach müssten die ersten Auswirkungen der Verstrahlung in der Region um Fukushima bereits sichtbar sein. Alles andere ist für den Physiker Augenwischerei.
Es gebe Indikatoren, die viele Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl in Deutschland und Westeuropa überraschend festgestellt wurden, sagt er n-tv.de. Zu diesen Indikatoren gehören eine erhöhte Totgeburtenrate, Säuglingssterblichkeit und Fehlbildungsrate bei Neugeborenen. Ein empfindlicher Punkt sei auch die mögliche Veränderung des Verhältnisses von geborenen Jungen zu geborenen Mädchen. Strahlen schädigen vor allem die weiblichen Embryonen, es werden vorwiegend weniger Mädchen geboren. Wenn man all dies berücksichtige, sei die Zahl der Opfer bereits sehr hoch.
Veränderte Erbinformation
Auch der Strahlenschutzexperte Bernd Ramm verweist bei n-tv.de auf die epigenetischen Folgen der Strahlung. Dabei werde die Erbinformation verändert, ohne dass sich die Sequenz der DNA ändert. Ramm erläutert, dass pro aufgenommenem Sievert Strahlung das Risiko einer Krebserkrankung um etwa zehn Prozent steigt. Das genetische Risiko nehme aber bereits bei sehr viel niedrigerer Strahlungsaufnahme zu. "Genau neun Monate nach Tschernobyl gab es in Berlin eine Spitze von Down-Syndrom-Kindern, die gleiche Spitze gab es in Weißrussland im Januar 1987", sagt Ramm.
Pflugbeil betont: "Wenn das in Deutschland nach Tschernobyl, Tausend Kilometer entfernt, bei sehr moderat erhöhten Strahlenwerten passiert ist, dann ist das in der Fukushima-Region mit Sicherheit auch so." Allerdings seien das Effekte, die man nicht auf der Straße sehe. "Danach müsste man gezielt suchen", weiß er.
Unstillbares Nasenbluten
Andere Symptome für die Folgen der Strahlungen seien hingegen augenfällig, so Pflugbeil. "Was wir schon sehen, ist ein verstärktes Auftreten von Nasenbluten. Das mag banal klingen, aber das ist das erste, was ich in der Tschernobyl-Region gesehen habe. Da stand ein Arztwagen vor einer Schule in Weißrussland und ich habe gefragt, ob es einen Unfall gegeben habe. Die Antwort war: Nein, der müsse jetzt jeden Tag da stehen, weil die Kinder so starkes Nasenbluten hätten, dass es kaum gestillt werden könne und die Kinder sogar ohnmächtig werden."

Ein Jahr nach der Reaktorkatastrophe ist die Lage in dem havarierten AKW alles andere als stabil.
(Foto: Reuters)
Das schwere Nasenbluten ist Pflugbeil schon aus Geheimberichten aus den 1950er Jahren aus dem kasachischen Atomwaffentestgebiet von Semipalatinsk vertraut. Die Experten dort hatten die Einwohner der umliegenden Orte beobachtet. Sie stellten fast, dass die Menschen starkes Nasenbluten hatten, dass sie häufig sehr schwer an Angina erkrankten. So schwer, dass sie ins Krankenhaus mussten und auch die Behandlung dort kaum anschlug. Hinzu kamen schwere Kopfschmerzen, Erkrankungen der Nerven- und Sinnesorgane. Es sind die gleichen Symptome wie nach Tschernobyl, wie nun in Japan. "Deshalb verstehe ich nicht, dass die Fachleute das jetzt in Japan nicht ernst nehmen."
Die noch harmlos wirkenden Anzeichen seien lediglich die Vorboten späterer Erkrankungen. Die Strahlung schädige offenbar zum Beispiel die kleinen Blutgefäße. "Bei Kindern kommt es dann zu Nasenbluten, bei den Liquidatoren in Tschernobyl führte das dann später verstärkt zu Schlaganfällen."
Eingelullt und desinformiert
In Japan werde die Bevölkerung über diese Gefahren jedoch nicht aufgeklärt, sondern "regelrecht eingelullt". Schon die Beteuerungen, es habe bisher keine Strahlentoten gegeben, hält Pflugbeil für wenig glaubhaft. Allerdings gebe es auch keine Daten, um diese Angaben zu widerlegen. "Alle , haben Schweigeverpflichtungen unterschrieben. Manchmal gibt es zufällige Berichte mit einigen Details, aber es gibt kein geschlossenes Bild."
Pflugbeil sieht darin die Mechanismen "gezielter Desinformation", wie er sie schon nach dem Super-Gau in Tschernobyl erlebt hat. Japans Regierung und einheimische Experten haben niedrige Strahlen-Dosen für unbedenklich erklärt. Das Gesundheitsrisiko durch eine Strahlenbelastung von 20 Millisievert im Jahr – erst darüber fängt man an, über Evakuierung nachzudenken – sei "niedriger als durch andere Krebsursachen" wie etwa Rauchen, sagen sie. Der Grenzwert für die Strahlenbelastung der Bevölkerung in Japan lag vor dem Unglück bei einem Millisievert im Jahr. Dabei ist die besondere Strahlenempfindlichkeit von Kindern noch gar nicht berücksichtigt.
Die nennt die Regierung "Strahlenphobie", unbegründete Ängstlichkeit vor der Radioaktivität. Alle sollen nur schön fröhlich sein, dann würden sie auch nicht krank. Nur traurige Leute bekämen die Strahlenkrankheit. Pflugbeil machen solche Ausführungen sprachlos: "Ich dachte nicht, dass man sich das nochmal traut. Das sagen Medizinprofessoren, und das ist alles erstunken und erlogen."
Insbesondere die Anwendung eines Grenzwertes von 20 Millisievert pro Jahr für Kinder hält Pflugbeil für einen Skandal. In Deutschland gelte der gleiche Wert als Höchstgrenze für beruflich strahlenexponierte Erwachsene. Die Menschen seien aber auch gar nicht informiert, wie hoch die Strahlenbelastung in ihrer Umgebung tatsächlich ist. Es gebe immer wieder Beispiele, dass die Menschen "noch in einem belasteten Gebiet leben oder dass sie gar aus einem weniger belasteten Gebiet in ein stärker belastetes umgezogen sind." Die Regierung verfolge jedoch die Linie, dass die Menschen nach Möglichkeit nicht wegziehen sollen. Pflugbeil sieht aber keine wirkliche Alternative zur Aufgabe der verstrahlten Gebiete. Noch immer kämen neue Belastungen hinzu.
Strahlung reichert sich an
Gerade habe die Schneeschmelze in den Bergen begonnen. "In den bewaldeten Bergen sind die radioaktiven Wolken hängengeblieben, das kommt jetzt in kleinen Bächen wieder heruntergelaufen und führt dazu, dass die Flüsse stärker radioaktiv belastet werden." Aus den Flüssen wird zum Teil noch Trinkwasser gewonnen, auch Fischfang gibt es dort weiterhin. Doch im Wasser wirke sich die Radioaktivität ganz anders aus als an Land, erläutert Pflugbeil und meint damit auch die Situation im Meer, das durch den Fallout und extrem hoch belastete Abwässer sehr stark kontaminiert wurde.
"Das gefährliche an der Wasserkontamination ist, dass die Nahrungsketten dort viel länger sind als an Land. Bei den vielen Stufen im Wasser reichern sich immer mehr radioaktive Stoffe in den Organismen an. Das heißt, dass Fische am Ende der Nahrungskette sehr viel höher belastet sind als das Wasser, in dem sie schwimmen." Für eine Fischfangnation wie Japan ist das eine doppelte Katastrophe. Die ganze Fischerei an der Ostküste von Fukushima bis Tokio ist praktisch zum Erliegen gekommen. Außerdem gibt es absurde Initiativen, die den Japanern nahelegen, nun gerade die in der Region Fukushima regional erzeugten Lebensmittel zu konsumieren.
Dimension nicht erfasst
Diese Ratschläge fügen sich für Pflugbeil allerdings ins Bild. Gerade werde den Menschen erzählt, dass in Kürze ein Reinigungsprogramm startet. Dann sollen der Boden abgetragen und Häuser abgespült werden. "Aber das hat man in Tschernobyl auch probiert, das hat wenig Sinn." Zwar sei die kontaminierte Fläche in Japan insgesamt kleiner, gerade nordwestlich von Fukushima gebe es aber Gebiete, "die noch höher belastet sind als der legendäre rote Wald in unmittelbares Nähe des KKW Tschernobyl".
Es gebe die Chance, Dinge besser zu machen als in Tschernobyl und die Verläufe wissenschaftlich zu untersuchen. Doch "die Japaner haben noch gar nicht verstanden, dass sie da eine jahrzehntelange Aufgabe vor sich haben." Von den psychosozialen Folgen, die der Verlust von Heimat und Existenzgrundlage sowie die ständige Angst vor der Strahlung mit sich bringen, sei noch gar keine Rede. Nach dem Erdbeben und dem Tsunami hat die Zahl der Selbstmorde in Japan drastisch zugenommen. Der Regierung zufolge wurden im Mai 2011 insgesamt 3375 Selbstmorde registriert, ein Fünftel mehr als im Vorjahresmonat.
Pflugbeil fürchtet, dass es nicht bei den bisherigen Belastungen bleiben könnte. Block Nummer vier des Atomkraftwerks Fukushima war zum Zeitpunkt des Unglücks nicht in Betrieb. Die hochaktiven Brennstäbe befanden sich zusammen mit etwa 1500 älteren im Abklingbecken. Dort sind sie immer noch. Doch die Konstruktion, die das Becken trägt, ist schwer beschädigt. Bräche sie zusammen, lägen die Brennstäbe ungekühlt frei. Innerhalb kürzester Zeit käme es zum Bersten der Brennelementehüllen, zur Freisetzung gigantischer Mengen hochgiftiger Radionuklide und zur Kernschmelze. Dann müsste die Evakuierungszone nach Einschätzung japanischer Fachleute auf bis zu 250 Kilometer ausgedehnt werden. In dieser Zone läge auch Tokio.
Quelle: ntv.de