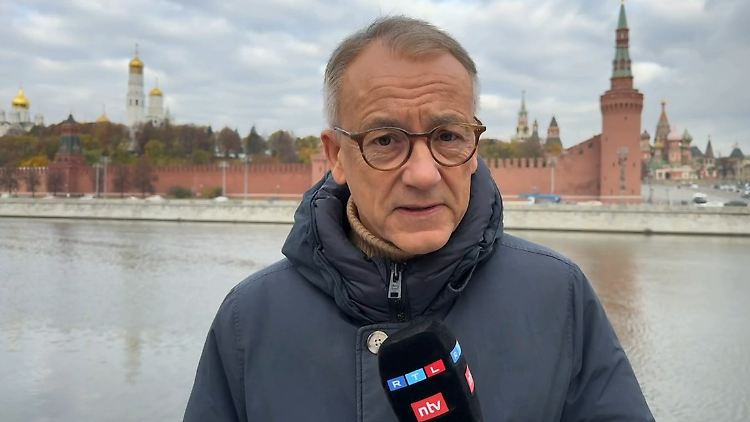Arbeitnehmer-Datenschutz Kabinett beschließt Gesetzentwurf
25.08.2010, 10:33 Uhr
Wann darf ein Arbeitgeber ins Postfach des Angestellten gucken?
(Foto: dpa)
Mit einem Gesetz will die Bundesregierung den Datenschutz von Arbeitnehmern verbessern. Nach diversen Schnüffel-Skandalen etwa bei der Deutschen Bahn, Lidl und der Deutschen Telekom legt das Kabinett nun den Entwurf vor. Die Arbeitgeber sind unzufrieden; sie sehen sich bei der Bekämpfung von Korruption und Kriminalität behindert.
Das Bundeskabinett hat einen Gesetzentwurf zum besseren Datenschutz für Arbeitnehmer beschlossen. Das verlautete aus Regierungskreisen. Die Regierung will mit dem Gesetz Beschäftigte vor Bespitzelungen schützen, Unternehmen aber auch verbindliche Regeln für den Kampf gegen Korruption liefern.
Das Gesetz ist eine Folge aus mehreren Datenschutzskandalen bei Großunternehmen in der jüngeren Vergangenheit. So waren etwa die Deutsche Bahn, die Deutsche Telekom oder der Discounter Lidl in Skandale um die Ausforschung ihrer Beschäftigten verwickelt.
Ein zentraler Punkt der geplanten Neuregelung ist, dass heimliche Überwachungen mit Kameras untersagt sein sollen. Vor einiger Zeit hatte Lidl für große Empörung gesorgt, weil dort Beschäftigte mit versteckter Kamera überwacht wurden. Die Neuregelung des Arbeitnehmer-Datenschutzes gilt als überfällig. Die Rechtsprechung ist in diesem Bereich uneinheitlich. Für viele Fragen gibt es keine oder aber komplizierte Regelungen.
Arbeitgeber fordern Nachbesserungen
Nach Auffassung der Arbeitgeber allerdings behindert der vorliegende Entwurf die Korruptions- und Kriminalitätsbekämpfung. Der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Reinhard Göhner, forderte deshalb Nachbesserungen. Zudem müssten weiterhin Betriebsvereinbarungen zum Datenschutz möglich sein, sagte er im ZDF. Der Gesetzentwurf, den das Kabinett jetzt beschloss, sieht das nicht mehr vor. Als dritten Punkt mahnte Göhner an, dass die geplanten Regelungen rechtsklar sein müssten. So sei in dem Entwurf schwammig formuliert, wann der Arbeitgeber in das E-Mail-Fach eines Mitarbeiters schauen dürfe.
Kritik äußerte der Hauptgeschäftsführer auch an dem geplanten Verbot der geheimen Videoüberwachung. Wenn es einen konkreten Verdacht einer Straftat gebe, müsse es möglich sein, diesen gezielt per Video zu überprüfen. "Ich glaube, dass das sehr viel vernünftiger ist für den betrieblichen Alltag und die Kriminalitätsbekämpfung, als gleich den Staatsanwalt zu holen", sagte Göhner.
Auch der Einzelhandel kritisierte den Gesetzentwurf. Ein generelles Verbot von verdeckter Videoüberwachung in Unternehmen wäre "quasi ein Rückschritt gegenüber der Rechtslage, die über viele Jahre bestand", sagte Thomas Bade, Arbeitsrechtsexperte des Hauptverbands des Deutschen Einzelhandels (HDE), dem Radiosender MDR Info.
Eine Überwachung beispielsweise von Lagerräumen ohne Wissen der Beschäftigten könne sinnvoll sein. Es gebe Situationen, "wo man mit den normalen Ermittlungen im Betrieb nicht mehr weiterkommt". Da sei die Videoüberwachung der letzte Weg, um Straftäter zu ermitteln. Ausgenommen seien in jedem Fall Toiletten und Umkleideräume.
"Zu viele Grauzonen"
Die Bundestagsfraktion der Linken beklagte unterdessen "zu viele Grauzonen" im vorliegenden Gesetzentwurf. Dass es "nach Jahrzehnten der Untätigkeit und zahlreicher Bespitzelungsskandale" endlich ein Gesetz zum Arbeitnehmer-Datenschutz geben werde, sei eine gute Nachricht. "Der große Wurf ist es aber leider nicht geworden, und in einigen Bereichen wird durch schwammige Regelungen neuen Datenschutzverletzungen Tür und Tor geöffnet", sagte Linksfraktionsvorstand Jan Korte.
Einigen Verbesserungen - wie dem Verbot der heimlichen Videoüberwachung oder der Überprüfung der Vermögensverhältnisse sämtlicher Mitarbeiter - stünden zahlreiche Ausnahmeregelungen und weitgehende Befugnisse zur Überwachung entgegen, so der Linken-Politiker. Von angemessenen und abschreckenden Sanktionen oder einer effektiven Stärkung der betrieblichen Datenschutzbeauftragten fehle aber jede Spur. Diese seien indes nötig, um den gesetzlichen Regelungen auch tatsächlich Wirkung zu verleihen.
Quelle: ntv.de, dpa