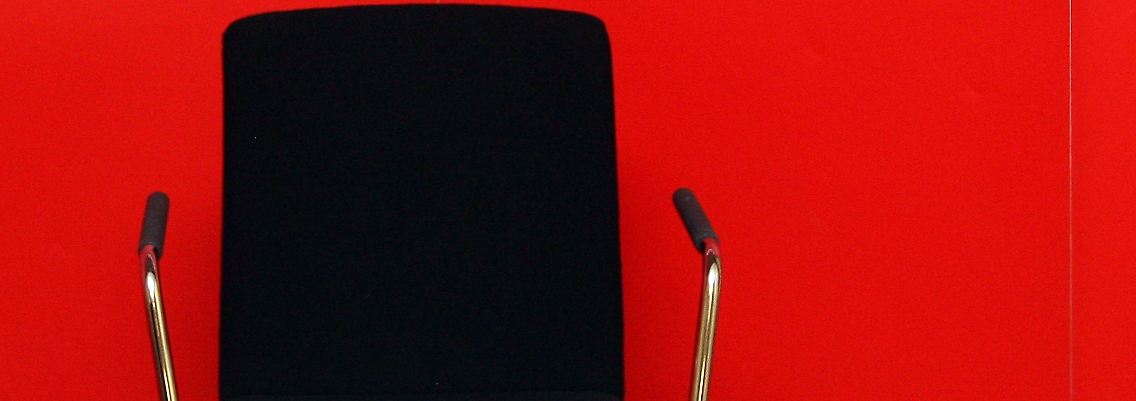Führungsstreit der Linken Lafontaine erzwingt die Scheineinigkeit
21.05.2012, 12:50 Uhr
Lafontaine geht vor allem in der Rolle des Oppositionspolitikers auf.
(Foto: picture alliance / dpa)
Oskar Lafontaine will sich wieder zum Vorsitzenden der Linken wählen lassen - aber nur, wenn sich ihm kein Kandidat entgegenstellt. Der 68-Jährige offenbart im Kampf um das Spitzenamt der Partei diktatorische Züge, er demonstriert ein hohes Maß an politischer Unreife. Ausgerechnet sein Gegenspieler Dietmar Bartsch hat ihm da einiges voraus.
"Der Zweck heiligt die Mittel." Historiker und Politikwissenschaftler schrieben diesen Satz schon vielen Persönlichkeiten zu: dem personifizierten Inbegriff der Machtpolitik Niccolò Machiavelli, dem größenwahnsinnigen französischen Kaiser Napoleon Bonaparte. Vielleicht werden sie künftig auch Oskar Lafontaine mit diesem Sprichwort in Verbindung bringen.
Der frühere Vorsitzende der Linken sagt: Er wolle das Amt an der Spitze der Partei wieder übernehmen – Lafontaine hat Gutes im Sinne, wenn er das sagt, doch er offenbart damit auch diktatorische Züge und politische Unreife. Dass der Zweck die Mittel nicht heiligt, hat er offenbar noch nicht verstanden.
Monatelang sorgte die Linke allein mit ihren Personalquerelen für Aufsehen. Im Mittelpunkt stand die Frage: Wer soll das Führungsduo Klaus Ernst und Gesine Lötzsch beerben? Als Lafontaine sich unter dem Vorbehalt entschied, das Amt nur zu übernehmen, wenn es nicht zu einer Kampfabstimmung kommt, wollte er Ruhe in diese Debatte bringen. Ein harmonisches Führungsduo sollte dafür sorgen, dass die Partei ihren Ruf einer gespaltenen Truppe verliert. Endlich würden dann wieder linke Themen die öffentliche Debatte bestimmen, nicht die parteiinternen Streitereien. So zumindest Lafontaines Hoffnung. Einigkeit, Harmonie - hehre Ziele. Doch Lafontaine greift dafür zu Mitteln, die an die düstere Vergangenheit eines Teils seiner Linken erinnert. Lafontaine versucht eine demokratische Abstimmung zu unterbinden, um eine Einigkeit zu demonstrieren, die es nicht gibt.
Die Linke ist gespalten, auch wenn das Lafontaine nicht passt
Tatsächlich durchziehen etliche Brüche die Linke. Im Osten ist die Geschichte der Partei zumindest in den vergangenen Jahren eine Erfolgsgeschichte. Sie regiert immerhin in Landtagen mit. Im Westen dagegen flog sie zuletzt in Schleswig-Holstein und dann in Nordrhein-Westfalen aus dem Parlament. Ihre Regierungsverantwortung im Osten zwingt die Linke in den neuen Bundesländern immer wieder zu bürgerlichen Kompromissen, stärkt die Reformer in der Partei. Im Westen geriert sie sich dagegen als Oppositionskraft äußerst radikal. 20 Jahre nach der Wende gibt es aber natürlich auch innerhalb der Ost- und Westverbände Flügelkämpfe. Die Reformer werfen den Traditionalisten eine allzu orthodoxe linke Politik vor. Die Traditionalisten befürchten, dass die Reformer ihre linke Seele für ein bisschen Regierungsbeteiligung verkaufen.
Lafontaine steht klar für den radikalen Flügel, er geht in der Rolle des Oppositionspolitikers ganz auf. Unmöglich kann sein Kurs als stellvertretend für die ganze Linke stehen. Dass er es trotzdem zu erzwingen versucht, zeigt, wie verzweifelt das Ringen um Einheit in der Partei dieser Tage ist. Dass ausgerechnet der Mann, den Lafontaine mit seiner Kandidatur unter Bedingungen aus dem Weg räumen will, ihm vormacht, wie man die tiefen Gräben in der Linken schließen könnte, ohne alle demokratischen Grundprinzipien zu missachten, lässt Lafontaine nicht gut aussehen.
Denn der Reformer Dietmar Bartsch ist anders als Lafontaine nicht nur bereit, sich im Kampf um das Amt einer richtigen Wahl zu stellen. Er hat auch vorgeschlagen, , obwohl die beiden als Widersacher gelten. Lafontaine setzt auf erzwungene Scheineinigkeit, Bartsch auf demokratische Prozesse und Dialog.
Quelle: ntv.de