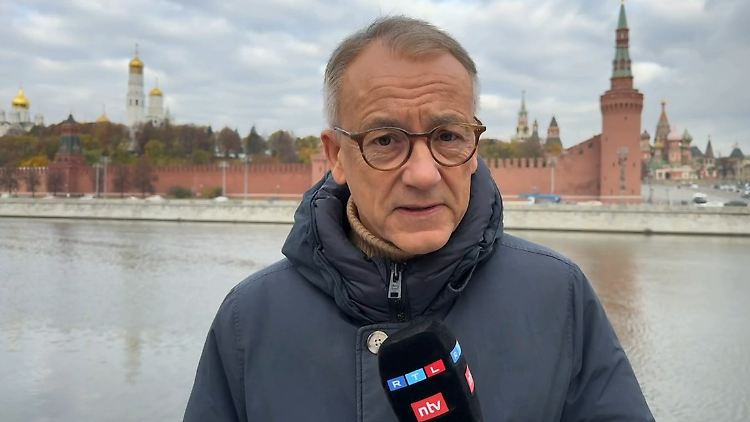Nicht überall unzulässig NRW darf Computer ausspähen
06.02.2007, 07:38 UhrDie Polizei darf Computer vorerst nicht heimlich über das Internet ausspionieren. Für so genannte Online-Durchsuchungen zum Beispiel von Terrorverdächtigen fehle die gesetzliche Grundlage, entschied am Montag der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Das Ausspähen von Daten mit Hilfe eines Programms, das ohne Wissen des Betroffenen auf seinen Computer aufgespielt wird, sei nicht durch die Strafprozessordnung gedeckt. Sie erlaube nur eine offene Vorgehensweise (AZStB 18/06 -Beschluss vom 31. Januar 2007).
Schäuble fordert neue Rechtsgrundlage
Die Online-Durchsuchung von PCs wird als Mittel zur Terrorbekämpfung diskutiert. Per E-Mail oder über eine Internet-Seite hätten Ermittler theoretisch die Möglichkeit, ein Schnüffel-Programm auf den Rechner von Verdächtigen einschleusen. Bundesinnenministerium, verschiedene Länder und Ermittler fordern nun rasch ein entsprechendes Gesetz. Datenschützer, Rechtsanwälte, Verleger, Journalisten und Oppositionspolitiker warnen dagegen vor dem "gläsernen Bürger".
Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU) will durchsetzen, "dass die Strafverfolgungsbehörden die Möglichkeit haben, eine Online-Durchsuchung nach entsprechender richterlicher Anordnung verdeckt durchführen können." Schäuble will Befugnisse für die Polizei, wie sie der Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen hat.
Spähen wie der Verfassungsschutz
Dort können noch immer Computer übers Internet ausgespäht werden. "Das BGH-Urteil bezieht sich nur auf die Befugnisse der Polizei und hat nichts mit unserem Verfassungsschutzgesetz zu tun", sagte Ministeriumssprecherin Dagmar Pelzer in Düsseldorf. Ein seit Januar geltendes Gesetz erlaube es dem Verfassungsschutz unter bestimmten Bedingungen, Computer extremistischer Terroristen heimlich zu kontrollieren.
Klage angedroht
Das neue Gesetz in NRW biete dem Verfassungsschutz eine Rechtsgrundlage und regele genau, wann die Behörde tätig werden darf, betonte Pelzer. In Frage komme eine Online-Durchsuchung etwa bei der Gefahr von Terroranschlägen, bei Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung oder bei Mord. Bisher sei das Gesetz noch nicht angewandt worden. Der ehemalige Bundesinnenminister Gerhart Baum (1978-1982/FDP) und Atomkraftgegner wollen nach eigenen Angaben Verfassungsbeschwerde gegen die NRW-Regelung erheben.
Bosbach: "Mittel ist unerlässlich"
Der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach aus NRW sagte der "Frankfurter Rundschau": "Ein solches Mittel ist unerlässlich, weil wir sonst eine erhebliche Ermittlungslücke bei der Strafverfolgung haben." Sein nordrhein-westfälischer SPD-Kollege Dieter Wiefelspütz forderte, es müsse genau definiert werden, was der "Kernbereich privater Lebensgestaltung" sei, der nicht angetastet werde dürfe.
Der Bund Deutscher Kriminalbeamter BDK und die Gewerkschaft der Polizei verlangten rasch eine klare Rechtsgrundlage, um schwere Verbrechen wie Kinderpornografie, Terrorismus oder Organisierte Kriminalität bekämpfen zu können. "Ich hoffe, dass die Politik schnell arbeitet. Ansonsten haben wir einen Freifahrtschein für Kriminelle - für eine unabsehbar lange Zeit", sagte der BDK-Vorsitzende Klaus Jansen.
Bayern forderte ebenfalls eine schnelle gesetzliche Regelung. "Wenn es um Lebensgefahren und Terrorismus, Kinderpornos geht, können wir darauf nicht verzichten", sagte Innenminister Günther Beckstein der Münchner "Abendzeitung". Niedersachsens Innenminister Uwe Schünemann (CDU) sagte, er sei froh, dass sich der Bundesinnenminister und auch die SPD zügig an die Erarbeitung eines Gesetzes machen wollten.
Eingriff in die Grundrechte
Nach Ansicht des 3. BGH-Strafsenats greift es erheblich in die Grundrechte des Betroffenen ein, wenn ein Ausspähungsprogramm auf den Computer eines Verdächtigen aufgespielt werde. Eine rechtmäßige Durchsuchung sei "dadurch geprägt, dass Ermittlungsbeamte am Ort der Durchsuchung körperlich anwesend sind und die Ermittlungen offen legen", heißt es in dem Beschluss. Die Online-Durchsuchung sei auch nicht mit der Telefonüberwachung vergleichbar, weil dabei nicht nur die Kommunikation zwischen dem Verdächtigen und einem Dritten überwacht werde. Vielmehr werde eine umfassende Übermittlung der auf dem Zielcomputer gespeicherten Daten an die Ermittler ausgelöst.
Bundesrechtsanwaltskammer, Anwaltverein und Datenschützer warnten die Politik davor, eine heimliche Ausspähung zu legitimieren. Die Online-Durchsuchung sei ein gravierender Eingriff in Freiheitsrechte und das informationelle Selbstbestimmungsrecht, warnte der Bundesbeauftragte für den Datenschutz, Peter Schaar.
"Konsequente und richtige Entscheidung"
In der High-Tech-Branche stieß das Urteil auf breite Zustimmung: "Verdeckte staatliche Zugriffe würden das Vertrauen von PC-Nutzern in den Schutz ihrer Privatsphäre im Internet zerstören", hieß es beim Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (Bitkom). Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) appellierte an das Innenministerium, den Richterspruch zu akzeptieren. Für die Medien bedeute das Urteil einen ersten Schritt zur Stärkung des Quellenschutzes und damit auch der Pressefreiheit, erklärte der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) in Berlin.
Auch die Opposition begrüßte die Entscheidung. "Eine Online-Durchsuchung übersteigt in der Intensität des Eingriffes den großen Lauschangriff", sagte die FDP-Rechtsexpertin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. . Die Grünen nannten die Entscheidung "konsequent und richtig" und sahen Schäuble und Justizministerin Brigitte Zypries (SPD) "beim Hacken erwischt". Die Linksfraktion sprach von einem "Glücksfall für die Bürgerrechte und für jeden, der einen internetfähigen Computer nutzt".
Quelle: ntv.de