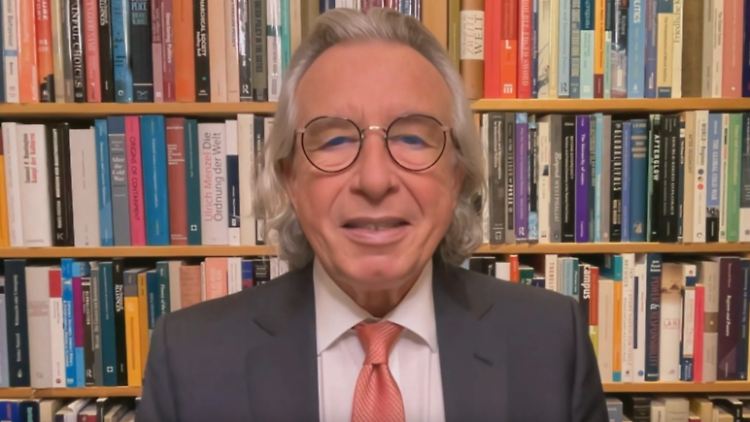Ein US-Republikaner in Berlin "Partei wurde gekidnappt"
29.08.2012, 16:33 Uhr
Auf dem Parteitag in Tampa wird Romney offiziell zum Präsidentschaftskandidaten nominiert.
(Foto: AP)
In den USA feiern sich gerade die . Der Unternehmensberater Ned Wiley betrachtet das Ganze aus der Diaspora Berlin, wo er sich regelmäßig mit einem Häufchen anderer Republikaner trifft. Er sieht seine Partei inzwischen gekidnappt "von Fundamentalisten, von rechts-religiösen Leuten", die allerdings ein wichtiger Teil der USA seien.
n-tv.de: Die Demokraten sind in Berlin relativ leicht zu finden, die Republikaner eher nicht. Ist diese liberale Stadt ein hartes Pflaster für sie?
Ned Wiley: Wir sind schon schwierig zu finden, ja. Es hat wohl damit zu tun, dass Berlin vor allem eine Stadt für Künstler ist. Und viele Künstler aus den USA kommen entweder von der Ost- oder der Westküste, also aus New York oder Kalifornien. Und das sind beides tief demokratische Staaten. Obama wird dort rund 80 Prozent der Stimmen holen, das wissen wir.
Wie viele US-Republikaner gibt es überhaupt in Berlin?
Wir sind eine kleine Gruppe. Bei unseren Treffen sind wir etwa zehn Leute insgesamt. Und fünf von ihnen sind Deutsche.
Deutsche?
Ja, jedenfalls sind sie offenbar sehr interessiert an uns. Warum, weiß ich nicht.
Wie ist die Stimmung zwischen dem "blauen" und dem "roten" Lager?
Also, ich war mal im Konsulat in Zehlendorf, um in Berlin lebenden US-Amerikanern zu erklären, wie man sich für die Wahl registriert. Ich war der einzige Republikaner da, der Rest: alles Demokraten. Als ich sagte, zu welcher Partei ich gehöre, haben die mich angeschaut, als ob ich eine Krankheit hätte. Diese Polarisierung ist schon sehr stark geworden in letzter Zeit. Ich treffe auch regelmäßig Demokraten in der "American Academy", übrigens eine Gründung von Richard Holbrooke (ehemaliger Top-Diplomat unter Clinton und Obama, Anmerkung der Redaktion). Aber wir sprechen dann nicht über Politik, das lohnt sich nicht. (lacht) Wir bleiben freundschaftlich.
Ihre Partei ist in den vergangenen Jahren stark nach rechts gerückt, vor allem bei Themen wie Abtreibung und Homo-Ehe. Zu welchem Flügel der Partei zählen Sie sich?
Unter Ronald Reagan war es das letzte Mal, dass ich mich als Republikaner richtig wohlgefühlt habe. Themen wie das Gesetz zur "Verteidigung der Ehe", wie es Konservative heute fordern, finde ich total uninteressant. Wenn zwei Homosexuelle heiraten und Kinder großziehen wollen: Prima, sollen sie machen! Das ist ihre Privatsache. Warum soll sich da die Regierung einmischen?
Genau das aber fordern viele Ihrer heutigen Parteigenossen.
Die republikanische Partei wurde gekidnappt. Von Fundamentalisten, von rechts-religiösen Leuten. Auch die sind natürlich ein wichtiger Teil Amerikas. Schauen Sie nur, wie viele Menschen dort noch in die Kirche gehen, das ist hier ganz anders. Aber seit den Bush-Jahren, denen von George Junior, sind sie noch viel mehr in diese Richtung gegangen. Leider, muss ich sagen.
Welche Konsequenzen haben Sie als moderater Republikaner daraus gezogen?
2008 habe ich für Obama gestimmt. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal tun würde. Aber konfrontiert mit der Wahl zwischen ihm und dem McCain-Palin-Team, habe ich gesagt: Das kann ich nicht akzeptieren. Das war das stereotype Bild von allem, was schlecht ist in Amerika. Ich konnte es einfach nicht. Ich habe republikanische Freunde, die sagen, dass Palin eine tolle Frau ist. Aber da habe ich die Grenze gezogen.
Sie haben ja durchaus etwas gemeinsam mit dem Präsidenten.
Stimmt, ich wurde in Chicago geboren. Interessanterweise im selben Krankenhaus, in dem später Michelle Obama als Kommunikationsdirektor gearbeitet hat. Im University of Chicago Hospital. Und gewohnt habe ich eine Zeit lang auf der 54. Straße, wo Barack Obama auch mal gewohnt hat. (lacht) Aber ich glaube nicht, dass wir gleichzeitig da waren.
Chicago ist seit vielen Jahrzehnten eine Hochburg der Demokraten. Wie wird man da zum Republikaner?
Dabei ist meine Familie auch eher demokratisch. Meine Brüder stehen politisch links, nur einer von ihnen ist eher libertär, so wie Ron Paul. Und wir Republikaner hatten auch einfach eine schwere Zeit. Erst mussten wir durch die Bush-Ära, mit all ihren Problemen. Mein Sohn war zweimal im Irak und ich frage mich: Wofür? Was hat das gebracht? Was wir da alles ausgegeben haben, und am Ende haben wir mehr Feinde geschaffen als bekämpft. Aber auch die Aufblähung des Staatsapparates. Ich habe schon 1992 nicht für Bush Senior gestimmt, weil er neue Steuern eingeführt hat. Meine Stimme ging an Ross Perot – vielleicht keine gute Idee, denn so kam Clinton an die Macht. Und ausgerechnet der hat dann fast republikanisch anmutende Reformen durchgeführt.
Aber das müsste Sie doch von den Demokraten überzeugen.
Nein, nein. Ich hatte ja auch Bedenken. Und dann wuchs unter Obama der Regierungsapparat riesig an. Der Anteil unseres Bruttosozialproduktes, den wir für den Staat ausgeben, wurde immer größer. Und ehrlicherweise muss man sagen: Die Republikaner haben das zuletzt immer mitgemacht. Vor ein paar Wochen war ich auch höchst unzufrieden. Das Feld der Präsidentschaftskandidaten war schwach, darunter vielleicht noch der Stärkste.
Was halten Sie von ihm?
Ich hatte am Anfang meine Probleme mit Romney. Angefangen mit seiner Religion: ein Mormone! Das ist für mich ein Kult. Ich war in Salt Lake City, ich war im Mormonentempel, ich weiß also ein bisschen was darüber. Es mag viele sehr religiöse Christen in den USA geben, aber ich gehöre nicht dazu. Ich bin das nicht. Aber muss man Christ sein, um Republikaner zu sein? Nein.
Hat sich an Ihrer Haltung etwas geändert?
Hätten sie mich vor ein paar Wochen gefragt, ich hätte Zweifel gehabt. Aber jetzt, wo er zu seinem Vize gewählt hat, bin ich überzeugt. Hätte er sich jemanden von der religiösen Rechten geholt, ich wäre bei der Wahl wohl zu Hause geblieben. Jetzt bin ich total enthusiastisch.
Was finden Sie an Paul Ryan so toll?
Er hat einen gründlich durchdachten Plan für die Verkleinerung des Staatsapparates. Gehen wir nicht in die Details, darüber wird noch genug gekämpft werden. Das Konzept aber, dass die Regierung sich weniger einmischen soll, das hat Ryan. Privatisierung der Krankenversicherung, ein einfacheres Steuersystem. Das sind Prinzipien, die die republikanische Partei in den vergangenen zehn Jahren völlig vergessen hat. Aber das kommt jetzt zurück!
Schauen wir aber doch mal auf eben diese Details: Von den wenigen Dingen, die feststehen, scheinen die meisten eher den Wohlhabenden zugutezukommen. Vor allem die Senkung der Steuern.
Ich finde, es ist zu früh, über die Einzelheiten zu reden, die sind einfach noch unklar. Aber die Demokraten wollen vor allem eines: den "Reichen" an den Kragen gehen. Dabei zahlen die schon viele Steuern. Ich bin total dafür, Sonderregelungen abzuschaffen. Aber wissen Sie, ich mache jedes Jahr zwei Steuererklärungen, in den USA und hier. Ich weiß nicht, welches Land das kompliziertere Verfahren hat, aber ich glaube, den Vergleich würden die USA gewinnen. Viel zu komplex! Und das ist die Idee des Ryan-Plans: einfacher machen. Für die Demokraten ist das kein Thema.
Klingt, als wäre Ihnen die Kombination Ryan - Romney lieber als die Variante Romney - Ryan.
Mal sehen, ich lasse mich überzeugen. In einem Magazin stand jetzt: "Herr Romney hat in Tampa viele offene Fragen zu beantworten." Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass die Grundprinzipien dieses Teams anders als bei Obama und Joe Biden sein werden. Wir haben dieses Jahr eine echte Wahl: Die Demokraten wollen, dass die Regierung alles bestimmt, zum Beispiel bei der Energiewirtschaft oder den Krankenversicherungen. Die Republikaner sagen, dass das der Privatsektor machen sollte. Mit Paul Ryan ist dieser Unterschied noch mal sehr klar geworden. Wir haben im November eine echte Wahl.
Mit Ned Wiley sprach Sebastian Schöbel.
Quelle: ntv.de