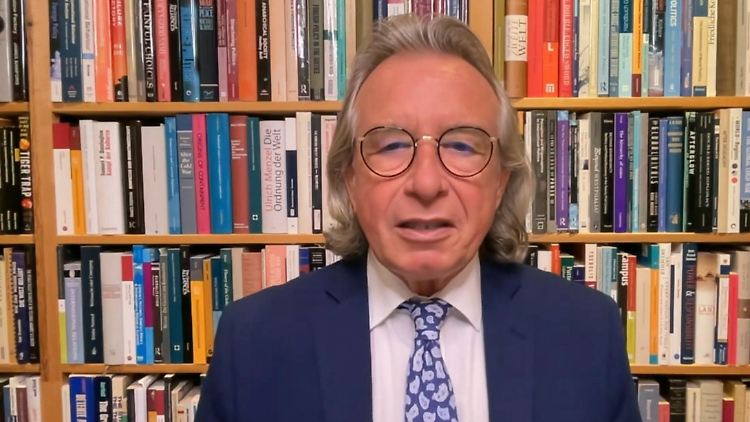"Demokratie im Irak war Totgeburt" USA hinterlassen gefährliches Vakuum
19.08.2010, 18:04 Uhr
Ende eines Einsatzes: Ein US-Soldat baut sein Maschinengewehr ab.
(Foto: APN)
Bewährungsprobe für den Irak: Er muss nun auf eigenen Beinen stehen. Gewinnt er dabei nicht zügig an Stabilität und Sicherheit, droht ein Bürgerkrieg.
Nun gilt es also für den Irak: Mit dem Abzug der letzten US-Kampftruppen steigt der Druck auf die Regierung in Bagdad, das ölreiche Land in sichere Bahnen zu lenken. Wobei schon dieser Satz zwei falsche Vorstellungen beinhaltet. Erstens bleiben noch 50.000 US-Soldaten im Irak. Zweitens gibt es auch mehr als fünf Monate nach der Wahl keine Regierung.
Und trotzdem weist der Abzug der sogenannten Kampftruppen auf eine Zäsur an Euphrat und Tigris hin. Denn je stärker sich die USA aus dem Land zurückziehen, desto mehr steht die irakische Regierung vor der Übernahme der vollen Verantwortung im Lande, mit allen Risiken und Nebenwirkungen.
Schiiten, Sunniten und Kurden
Mehr als sieben Jahre nach dem Sturz Saddam Husseins geht es für den Irak als Staat um nicht weniger als das Überleben. Für viele Menschen wurde im Alltag die Angst vor Husseins Schergen durch die Angst vor Anschlägen und Überfällen abgelöst. Mehr als 100.000 Zivilisten kamen seit 2003 nach Angaben von "Iraq Body Count" ums Leben. Neben Terror und Gewalt sind es aber vor allem die Konflikte zwischen den Volksgruppen für andauernde Instabilität im Lande. Schiiten, Sunniten und Kurden kämpfen um Einfluss und Kontrolle. Ganz besonders dort, wo es um die wichtigste irakische Einkommensquelle geht: das Öl.
Die große Mehrheit der rund 30 Millionen Iraker gehört der muslimischen Glaubensrichtung der Schiiten an. Sie waren es, die am stärksten unter der Herrschaft Husseins zu leiden hatten, der seine eigene Glaubensbrüder – die Sunniten – privilegiert hatte. Hinzu kommen die Kurden im Norden des Landes, deren ebenfalls sunnitischer Glaube sie aber nicht vor Verfolgung schützte.
Wem gehört das Öl?
Die neu gewonnene politische Freiheit führt seit dem Sturz Husseins noch immer zur Klärung der Kräfteverhältnisse. Anfang geschah das oftmals auch noch mit Waffen. Schiiten wie Sunniten hatten ihre eigenen Milizen, vor allem die sunnitischen Kämpfer rebellierten anfangs gegen das neue Herrschaftssystem, dessen Verlierer sie waren. Nach Angaben des Irak-Experten Guido Steinberg, Mitarbeiter bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, entschieden die schiitischen Milizen den Bürgerkrieg 2007 aber für sich. "Die meisten sunnitschen Aufständischen haben den Kampf mittlerweile aufgegeben", sagte er n-tv.de. Für die anhaltende Gewalt sind deshalb in erster Linie ausländische Kämpfer verantwortlich, die zum Umfeld von Al-Kaida zählen oder anderen terroristischen Gruppen angehören.
Die Kurden haben es derweil im Norden rund um Mosul als dominierende Volksgruppe geschafft, für relativ stabile Verhältnisse unter großer Autonomie zu sorgen. Ähnlich klar ist die Lage im Süden des Landes bei Basra, einem traditionellen schiitischen Gebiet. Die ehemals vorherrschenden Sunniten dominieren vor allem in der ressourcenarmen Mitte des Landes und fürchten, nun ihren Einfluss endgültig zu verlieren. Und überall dort, wo die Gruppen aufeinandertreffen, kämpfen sie um die Vorherrschaft. Etwa in Kirkuk im Norden, wo es um die Kontrolle von rund 40 Prozent der irakischen Ölvorräte geht; im Süden, wo ebenfalls große Ölfelder liegen; und natürlich in Bagdad, dem Sitz der Zentralregierung.
Land ohne Regierung
Wenn es denn eine gäbe. Die Parlamentswahlen am 7. März haben keinen eindeutigen Sieger hervorgebracht. Die meisten Sitze erhielt zwar die Al-Irakija-List von Ija Allawi. Doch brachte der Schiit bislang ebenso wenig eine Koalition zustande wie sein schiitischer Konkurrent Nuri al-Maliki, der mit seiner Rechtsstaats-Allianz noch als Ministerpräsident amtiert. Beide beanspruchen den Posten des Regierungschefs für sich. Beide pochen auf ihre konfessionsübergreifenden Parteibündnisse. Alle Gespräche für eine gemeinsame Regierungsbildung scheiterten bislang. Deshalb könnte es durchaus sein, dass sich Allawi mit der drittstärksten Partei des Landes verbündet, der Nationalen Irakischen Allianz des radikalen Schiitenführers Muktada al-Sadr.
Auch nach der Wahl 2005 dauerte es sechs Monate, bis eine neue Regierung gefunden war. Damals waren die USA allerdings noch mit weiter über 100.000 Soldaten im Irak vertreten. Trotzdem kam es 2006 und 2007 zur bislang schlimmsten Welle von Terror und Gewalt mit tausenden Toten. Nun aber haben sich die US-Truppen längst aus allen großen Städten zurückgezogen, die verbleibenden 50.000 Soldaten sollen zur Ausbildung und Unterstützung der irakischen Sicherheitskräfte dienen.
Perspektive 2020
Die allerdings können ihren Job bislang nicht erfüllen. Selbt der Befehlshaber der irakischen Truppen, Generalleutnant Babakir Sebari, sagt, dass seine Soldaten erst 2020 in der Lage seien, das Land zu verteidigen. Auch wenn man nicht so pessimistisch sein will: Die abziehenden US-Soldaten hinterlassen ein Vakuum. Und es gibt viele Kräfte, die das ausnutzen wollen.
Wohl nicht zufällig ist in den vergangenen Wochen die Zahl der Anschläge wieder deutlich angestiegen. Die Aufständischen und Terroristen wittern Morgenluft und versuchen, die Sicherheitskräfte zu schwächen. Deshalb treffen ihre Bomben und Angriffe vor allem Kasernen, Rekrutierungsbüros und Stützpunkte von Polizei und Armee.
Irak-Experte Steinberg ist zwar wie viele Beobachter nicht der Meinung, dass die Terroristen noch eine Gefahr für den Gesamtstaat Irak sind. Vielmehr wollten sie die Konflikte zwischen den Bevölkerungsgruppen schüren. Doch das wäre Gefahr genug.
Wer stößt ins Vakkum?
Deshalb ist das Fehlen einer neuen Regierung auch so dramatisch. Ohne neue Machthaber in Bagdad, die Streitkräfte und Sicherheitsleute koordinieren und für klare Verhältnisse sorgen, haben die terroristischen Kräfte leichteres Spiel.
Zudem sollte es im eigenen Interesse der Parteien liegen, der Bevölkerung stabile Lebensverhältnisse zu ermöglichen. Sonst verlieren die Menschen irgendwann die Geduld. Ihr Alltag ist von Terror und Gewalt geprägt, von ständiger Präsenz von Polizei und Militär, Straßensperren und Personenkontrollen. Auch wenn die USA verhasst sind – ihre Soldaten garantierten doch wenigstens einen gewissen Schutz. Deshalb macht ihr Abzug den Menschen auch ein bisschen Angst.
"Ich glaube, dass es im Irak inzwischen viele Menschen gibt, die so leben wie ich - in ständiger Panik", sagte etwa eine Lehrerin einer deutschen Nachrichtenagentur. "Dass die Gewalt in den vergangenen Monaten wieder zugenommen hat, ist ein Warnsignal. Es zeigt uns, dass jeder Abzug der Amerikaner für unser Land große Gefahren birgt." Ihr Vertrauen in die politischen Kräfte des Landes nach dem Sturz Husseins ist allerdings gering. "Hier im Irak war die Demokratie eine Totgeburt", sagte die Frau.
Staatspräsident Dschalal Talabani forderte die Parteiführer nach dem Abzug der letzten US-Kampftruppen deshalb auf, sich endlich auf die Bildung einer "Regierung der nationalen Partnerschaft" zu einigen. Denn nicht nur der Terror im eigenen Land stellt eine Gefahr für den Irak dar. Sollte nicht bald eine stabile Regierung im Amt sein, könnten auch andere Kräfte von außen das politische Vakuum nutzen: Saudi-Arabien etwa, oder der Iran.
Quelle: ntv.de, mit Material von dpa/AFP/rts