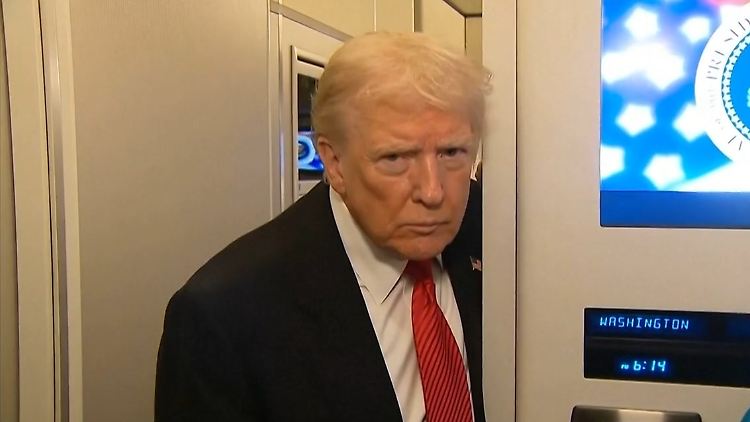Streit um Sparziele und Studienplätze Wehrreform bringt mehr Probleme
10.12.2010, 17:27 Uhr
(Foto: dapd)
Die Bundeswehrreform wird zur Bewährungsprobe für Schwarz-Gelb. Während Verteidigungsminister Guttenberg bezweifelt, dass er das vorgegebene Sparziel erreichen wird, will Finanzminister Schäuble keine Zugeständnisse machen. Zudem sind Bund und Länder uneins, wer die Kosten für die zusätzlich zu erwartenden Studienanfänger übernimmt.
Die Bundeswehrreform bringt die Finanzplanung der schwarz-gelben Koalition für die nächsten Jahre ins Wanken. Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg äußerte Zweifel daran, dass mit der von den Koalitionsspitzen vereinbarten Truppenstärke von bis zu 185.000 Mann das für seinen Etat verhängte Sparziel von 8,4 Milliarden Euro erreicht werden kann. "Hier werden wir viel Kreativität aufbringen", sagte der CSU-Politiker.
Das Finanzministerium und führende Vertreter der Koalition betonten hingegen, an den Sparvorgaben werde nicht gerüttelt. In der FDP hieß es, Guttenberg müsse notfalls bei umstrittenen Rüstungsprojekten mehr einsparen als geplant. Strittig ist zwischen Bund und Ländern auch noch, wer für die Kosten aufkommen wird, die durch die erwartete höhere Nachfrage nach Studienplätzen entstehen.
"Der 1. Juli ist der Stichtag"
Dem Beschluss des Koalitionsausschusses zufolge soll die Wehrpflicht mehr als 50 Jahre nach der Einführung zum 1. Juli nächsten Jahres ausgesetzt werden, sie bleibt jedoch im Grundgesetz erhalten. Die Zahl der Soldaten soll von 240.000 auf maximal 185.000 sinken - darunter bis zu 15.000 Freiwillige. Einen Gesetzentwurf will das Kabinett kommende Woche beraten.
Wann die letzten Soldaten mit Wehrpflicht eingezogen werden, ist offen. "Der 1. Juli ist der Stichtag. Das heißt, dass bis dorthin auch noch einberufen wird. Das sind allerdings größtenteils bereits gemusterte junge Männer", sagte Guttenberg in der ARD. Mit Blick auf die Zukunft der Standorte sagte er, die Bundeswehr werde in der Fläche weiter präsent sein.
Guttenberg hatte für eine Truppenstärke von 180.000 bis 185.000 Soldaten plädiert. Die Einsparsumme von rund acht Milliarden Euro bezog sich aber auf eine Truppenstärke von 163.500 Mann. "Bei einer Truppenstärke, die über den 163.500 liegt, dieser Minimallinie, die ich aufgezeigt habe, ist klar, dass höhere Kosten entstehen", sagte der CSU-Politiker.
"Keine Sicherheitspolitik nach Kassenlage"
Bei allen Teilnehmern der Koalitionsrunde habe Einigkeit geherrscht, "dass es keine Sicherheitspolitik nach Kassenlage geben soll und geben darf", sagte Guttenberg. Die Entscheidung sei auch von Finanzminister Wolfgang Schäuble mitgetragen worden. Gleichwohl sei sein Ressort aufgerufen, so effizient und so sparsam wie möglich zu agieren. Ein Sprecher ergänzte, bei den Beratungen für den Haushalt 2012 müssten Dinge wie die Anschubfinanzierung neu besprochen werden.

Verteidigungsminister Guttenberg schreitet in Straßburg beim Aufstellungsappell die Teile des deutschen Truppenteils der Deutsch-Französischen Brigade ab.
(Foto: dpa)
Das Finanzministerium machte Guttenberg keine Hoffnung auf Lockerung des Sparziels: "Das Bundesverteidigungsministerium ist weiterhin verpflichtet, die im Rahmen des Zukunftspakets beschlossenen Einsparungen zu erbringen", sagte ein Sprecher. FDP-Generalsekretär Christian Lindner und CSU-Landesgruppenchef Hans-Peter Friedrich stellten klar, an der mittelfristigen Finanzplanung werde nicht gerüttelt. Allerdings könnten nach Angaben aus Koalitionskreisen neue Sparvorgaben auf die anderen Ressorts zukommen. Zudem wurde darauf verwiesen, dass Guttenberg mit der Vorgabe einer Armee mit "bis zu" 185.000 Soldaten, einen gewissen Gestaltungsspielraum habe.
Länder und Bund streiten um Kosten
Nach Angaben des Bildungsministeriums ist unter anderem wegen des Wegfalls des Wehr- und Zivildienstes mit 34.600 bis 59.000 zusätzlichen Studenten zu rechnen. Hier wirkt sich auch aus, dass ab 2011 in mehreren Bundesländern durch die verkürzten Schulzeiten zwei Jahrgänge gleichzeitig Abitur machen. Die zusätzlichen Kosten beliefen sich für Bund und Länder auf 900 Millionen bis 1,5 Milliarden Euro im Zeitraum von 2011 bis 2018, sagte eine Sprecherin. Wer für die Finanzierung aufkommen werde, sei Gegenstand von Verhandlungen.
Laut Friedrich steht fest, dass die Länder aus dem Etat von Bundesbildungsministerin Annette Schavan entlastet werden sollen. Die CDU-Politikerin betonte dagegen, der Bund stehe zum Hochschulpakt. Aus ihm werden Uniplätze bislang je zur Hälfte von Bund und Ländern finanziert. "Angesichts des Fachkräftebedarfs sollten wir es als große Chance betrachten, dass mehr junge Leute in den nächsten Jahren früher eine Ausbildung oder ein Studium beginnen." Dafür müssten Kapazitäten geschaffen werden, sagte Schavan.
Dagegen forderte die nordrhein-westfälische Wissenschaftsministerin Svenja Schulze von der SPD den Bund auf, die zusätzlichen Studienplätze allein zu finanzieren. Die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen müssten in den nächsten Jahren bereits den doppelten Abiturjahrgang bewältigen, sagte Schulze in Düsseldorf. "Wenn der Bund unseren Hochschulen jetzt kurzfristig mit der Abschaffung der Wehrpflicht noch eine zusätzliche Aufgabe aufhalst, dann kann er sich nicht aus seiner Finanzierungspflicht stehlen", sagte Schulze.
Neuer Bundesfreiwilligendienst kommt
Die Regierung will am kommenden Mittwoch auch den neuen Freiwilligendienst verabschieden. Der Bundesfreiwilligendienst sei eine historische Chance für mehr gesellschaftliches Engagement, sagte CDU-Familienministerin Kristina Schröder. Sie wies Länder-Bedenken zurück. Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) würden weitgehend gleich ausgestattet wie der Dienst des Bundes.
Schröder will rund 35.000 Männern und Frauen pro Jahr mit dem Bundesfreiwilligendienst die Chance zum gemeinnützigen Einsatz bieten. Er soll das FSJ und das FÖJ ergänzen. Der Bund will die Dienste insgesamt mit 350 Millionen Euro pro Jahr fördern.
Quelle: ntv.de, rts/dpa