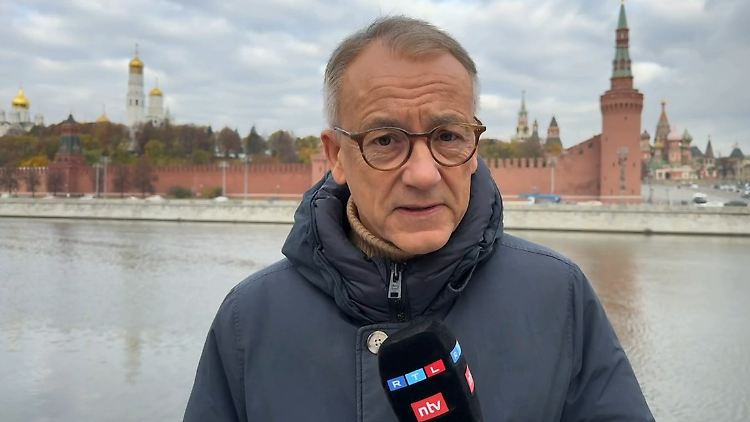Als Flevoland entstand 75 Jahre IJsselmeer
22.05.2007, 09:40 UhrVor 75 Jahren wurde in den Niederlanden die Zuidersee vom Wattenmeer getrennt. Diese ehemals wilde Nordseebucht erhielt den Namen IJsselmeer.

Schlittschuhläufer im Dezember 2002 auf dem IJsselmeer
Zum letzten Mal entlud die Baggerschaufel ihren steinigen Inhalt auf das schon im Wasser liegende Geröll - um 13.02 Uhr war der Deich geschlossen. Vor 75 Jahren, am 28. Mai 1932, wurde in den Niederlanden die Zuidersee vom Wattenmeer getrennt. Wenige Monate später erhielt diese ehemals wilde Nordseebucht den Namen, unter dem sie heute Urlaubern und Seglern bekannt ist: IJsselmeer.
In Jahre langer Plackerei hatten Tausende Arbeiter weit mehr als 50 Millionen Kubikmeter Sand, Steine und Lehm ins Meer geschüttet. So formten sie einen fast schnurgeraden Damm von der Spitze der Provinz Nord-Holland bis hinüber nach Friesland - gut 30 Kilometer lang und auf Wasserhöhe 90 Meter breit. Rund 400 Kilometer Küstenlinie, die bis dahin die Zuidersee begrenzten, dürfen sich seitdem vor tosenden Sturmfluten geschützt fühlen.
Drei Jahre nach Vollendung des "Abschlussdeiches" war aus der salzigen Zuidersee ein Süßwasser-Binnensee geworden. Die Seefische verschwanden, viele Zuiderzee-Fischer gaben auf. Und es entstand neues Land. Im Südosten des IJsselmeeres wurden große Polder geschaffen, sie formen heute die jüngste Provinz der Niederlande, Flevoland. Der Name ihrer Hauptstadt - Lelystad - erinnert an den "Vater" des IJsselmeeres, den Ingenieur und späteren Minister Cornelis Lely.
Ein von Lelystad in nordwestlicher Richtung nach Enkhuizen führender Damm, der Houtribdijk, zeugt noch von Lelys Plänen, die Zuidersee völlig trocken zu legen. Dieser Damm trennt das IJsselmeer vom Markermeer, das ein weiterer Polder werden sollte. "Aber unser Denken hat sich verändert", sagt Fred Delpeut vom regionalen Wasserbauamt. "Nicht mehr Landgewinnung steht im Vordergrund, sondern die Frage, wie wir mit dem Wasser umgehen können und müssen."
Und das sind, in einer Zeit von Klimaveränderung und häufiger werdenden Unwettern, schwierige Fragen. Bei der jüngsten Bewertung gab es mehrfach "ungenügend" für den 75 Jahre alten Abschlussdeich. Lely ging aus von einem maximalen Wasserstand von 3,50 Meter über Normal. Schon bei der Sturmflut 1953, die vor allem den Südwesten der Niederlande traf, stieg das Wasser auf 3,80 Meter über Normal. Heute will man sich gegen fünf Meter hohe Fluten schützen.
"Bei einem Supersturm, wie er alle 10.000 Jahre vorkommen kann, würden große Mengen Wasser vom Wattenmeer über den Abschlussdeich schlagen", beschreibt Projektmanager Eric Regeling die Gefahr. Nach niederländischem Recht müssen alle Deiche einem solchen - noch nie da gewesenen - Sturm trotzen können. "Ein Bruch ist nicht zu befürchten, dank der Stabilität der in dem Deich verbauten besonderen Lehmsorte", versichert Regeling. Dennoch muss der Deich verstärkt werden.
Ein weiteres Problem ist der Wasserhaushalt. Das IJsselmeer wird ständig aufgefüllt durch die IJssel, einen Mündungsarm des Rheins, und durch Regen. Damit es nicht über die niedrigen Ufer tritt, wird überschüssiges Wasser regelmäßig durch Schleusen im Abschlussdeich ins Wattenmeer gelassen: Wenn bei Ebbe das Watt fast trocken liegt, ist der Wasserspiegel im IJsselmeer höher. Dann werden die Schleusen geöffnet und das Süßwasser strömt hinaus ins Watt. Diese Möglichkeit wird sich aber immer seltener bieten, wenn der Meeresspiegel wegen der Erderwärmung steigt. Deshalb werden im Osten des Abschlussdeiches weitere Schleusen gebaut, um die Kapazitäten zu erhöhen.
"Voraussichtlich müssen wir den Pegelstand im IJsselmeer erhöhen, wenn der Seespiegel weiter steigt", sagt Experte Regeling. Dann müssten wohl auch die Deiche rund um den See erhöht werden - genau das sollte mit dem Abschlussdeich überflüssig werden. Dennoch ist Regeling davon überzeugt, dass der Abschluss der Zuidersee auch aus heutiger Sicht richtig war, nicht nur zum Schutz vor Hochwasser. Der riesige Süßwasservorrat des IJsselmeeres ist für die Versorgung von Menschen und Landwirtschaft längst unverzichtbar geworden.
Quelle: ntv.de, Thomas P. Spieker, dpa