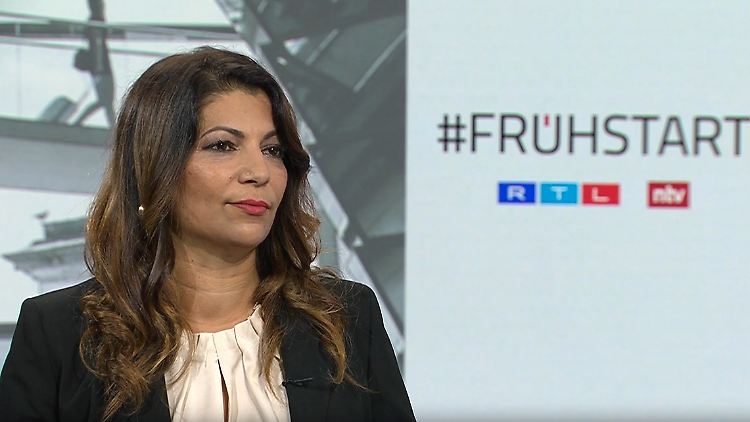Winfried Hermann bei n-tv.de "Autobahnbau ist Unsinn"
16.04.2008, 09:59 UhrDas Netz der Autobahnen und Bundesstraßen in Deutschland sei bereits so groß, dass die Belastung, es zu erhalten, Jahr für Jahr wachse, sagt Winfried Hermann, Verkehrsexperte der Grünen. Ein Ausbau von Autobahnen komme "nur an einigen völlig überlasteten Hauptachsen in Form von Erweiterung der Spuren infrage".
n-tv.de: Die französische Regierung hat im Herbst 2007 erklärt, sie wolle vom Prinzip des Autobahnausbaus "zu einem umfassenden Ausbau der alternativen Transportmöglichkeiten" übergehen. Straße und Flugzeug sollen "nur als letzte Alternative bei unumgänglicher technologischer oder geografischer Notwendigkeit Verwendung finden dürfen". Wäre eine so radikale Initiative auch in Deutschland denkbar?
Winfried Hermann: Nein, Deutschland ist mehrheitlich noch immer ziemlich autoverliebt.
Frankreich doch auch.
Stimmt. Ich bin deshalb auch skeptisch, ob die französische Regierung dieses Programm wirklich so konsequent durchsetzen wird. Ein konkretes Konzept gibt es noch nicht. Trotzdem ist die Ankündigung beachtlich. Wenn ein deutscher Minister so etwas gesagt hätte, wäre er wahrscheinlich gesteinigt worden.
Aber Sie wären dafür?
Wir sagen seit Jahren, dass der Neubau von Autobahnen ziemlicher Unsinn ist. Das Netz der Autobahnen und Bundesstraßen in Deutschland ist schon so groß, dass die Belastung, es zu erhalten, Jahr für Jahr wächst. Wir haben schon heute nicht genügend Mittel, das Netz im jetzigen Zustand zu erhalten! Manche Straßen sind inzwischen nur noch eingeschränkt befahrbar. Ein Ausbau kommt nur an einigen völlig überlasteten Hauptachsen in Form von Erweiterung der Spuren infrage.
War die alte Position der Grünen nicht "mehr Straßen sorgen für mehr Verkehr"?
Davon sind wir immer noch überzeugt. Viele Straßen haben sehr viel Verkehr erzeugt. Manche Achsen sind jedoch dauerhaft so überlastet, dass sie verstärkt werden müssen. Das betrifft etwa die A 8, die A 6, die A 5. Da gibt es Passagen, die so überlastet sind, dass man eine Erweiterung rechtfertigen kann. Das gilt auch für einige Umfahrungsstraßen. Ein Beispiel aus Tübingen, meinem Wahlkreis: Durch die Stadt verläuft eine Bundesstraße, die ein Verkehrsaufkommen hat wie eine Autobahn. Vor und hinter Tübingen ist sie vierspurig, in der Stadt und auf einer Länge von zehn, 15 Kilometern davor im Süden ist sie zweispurig. Die Folge ist Dauerstau. Außerdem teilt die Straße die Stadt, für die Anwohner ist der Verkehr eine Zumutung. Da muss ein Tunnel gebaut werden. Das ist teuer, aber im Interesse der Gesundheit und der Lebensqualität dringend notwendig. Solche und ähnliche Fälle gibt es leider noch viele.
Die Bundesregierung hat den Klimawandel zu einem großen Thema gemacht. Ist das in ihrer Verkehrspolitik zu spüren?
Im Verkehrsbereich ist die Politik der Bundesregierung am wenigsten stringent und nicht wirklich am Klimaschutz orientiert. Bei Zukunftskongressen reden die Minister Gabriel oder Tiefensee über die Notwendigkeit des Klimaschutzes, dass wir weg müssen vom Öl, dass wir klimafreundliche Zukunftstechnologien fördern müssen und dergleichen. Die alltägliche Politik des Bundesverkehrsministeriums ist eine Politik des Straßenausbaus, der Großprojekte, des Kampfes gegen das Tempolimit, obwohl Tempolimit die einzige Maßnahme ist, die fast kostenlos zu haben ist und erheblich mehr Energie und CO2 einspart als viele andere Maßnahmen. Stattdessen schwingt sich die Bundesregierung in Brüssel zum Oberlobbyisten der deutschen Automobilindustrie auf, verteidigt ihre hohen CO2-Ausstöße und den hohen Verbrauch der deutschen Autos - Artenschutz für die Premium-Klasse.
Im geltenden Bundesverkehrswegeplan sind 39,8 Milliarden Euro für den Aus- und Neubau von Autobahnen und Bundesstraßen vorgesehen.
Wir mahnen in jedem Jahr an, dass die Bundesregierung endlich kritisch bilanziert, was sich im Verkehrsbereich entwickelt hat, wo die Prognosen richtig waren, wo sie von der Realität überholt oder widerlegt wurden. Viele Straßenbauprojekte des Bundesverkehrswegeplans, bei denen noch nicht einmal mit dem Bau begonnen wurde, basieren auf Prognosen und Berechnungen aus den 90er Jahren. Der Verkehr ist ja nicht überall gewachsen und hat sich öfters anders entwickelt als erwartet.
Wenn man sich die Karte des Bedarfsplans für die Bundesfernstraßen anschaut, findet man ziemlich viele rote Strecken, die "vordringlichen Bedarf" haben. Da sind ein paar Sachen dabei, wo man als Laie stutzt, zum Beispiel die A 14 von Magdeburg nach Norden, oder die A 10 und A 24, der nördliche Berliner Ring und die Autobahn Richtung Hamburg. Das sind Strecken, ...
... die man nicht wirklich dringlich braucht.
Wie kommen die in den Bundesverkehrswegeplan?
Da gab es irgendwann Prognosen, die einen Ausbau gerechtfertigt haben - oder die Prognosen wurden entsprechend hingebogen. Und da gab es viele Aufbau-Geschenke mit dem Titel "Verkehrsprojekte Deutsche Einheit". Und wenn eine Straße erst mal im "vordringlichen Bedarf" ist, kriegen Sie die praktisch nicht mehr raus. Dahinter steht mitunter eine jahrzehntelange Entscheidungsgeschichte. Zunächst wird über viele Jahre in den Kommunalparlamenten über die Verkehrsführung gestritten. Dann wird im Landtag debattiert, die Landesregierung setzt entsprechend ihre Prioritäten, die Wirtschaft meldet sich zu Wort und die Wahlkreisabgeordneten agieren als Wahlkreislobbyisten. Irgendwann kommt eine Strecke auf Bundesebene in den "vordringlichen Bedarf". Daneben gibt Mechanismen, die grundsätzlich nicht schlecht sind, aber hier fatal wirken: Nach der Wende gab es eine klare Priorisierung des Straßenbaus im Osten. Das war anfangs berechtigt, hat später aber zu überdimensionierten Projekten geführt.
Wie läuft die Verteilung heute?
Es gibt einen Schlüssel, nach dem der Anteil eines Landes am Bundesverkehrswegeplan berechnet wird. Weil jedes Bundesland was kriegen muss, werden auch Projekte reingehievt, die man im Bundesmaßstab nicht begründen kann. Selbst Mecklenburg-Vorpommern bekommt noch immer Projekte mit "vordringlichem Bedarf". Das ist absurd.
Zwei Fraktionskollegen von Ihnen haben untersucht, ob es überhaupt stimmt, dass Straßenbau zum wirtschaftlichen Aufschwung einer Region beitragen kann. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass die Autobahnentfernung als Standortfaktor nur eine untergeordnete Rolle spielt.
Ein weiteres Fazit war, dass der Straßenbau keine Jobmaschine ist, sondern eher dazu führt, dass Räume entleert werden.
Weil die Leute auf den neuen Straßen weiter weg zur Arbeit fahren?
Fahren können, ja.
Was soll mit den 39,8 Milliarden Euro geschehen, die der Bundesverkehrswegeplan für den Bau von Autobahnen vorsieht? Alles in die Schiene stecken?
Nein, da mache ich mir nichts vor. 80 Prozent des Personenverkehrs und 70 Prozent des Güterverkehrs gehen über die Straße. Das kriegt man nicht alles auf die Schiene. Wir können das Straßennetz nicht zurückbauen, wir müssen das bestehende optimieren, effizient ausnützen und uns auf den Erhalt konzentrieren. Natürlich müssen wir umschichten in Richtung Schiene und ÖPNV. Wir müssen mehr Güter auf die Schiene bringen. Aber es ist ja nicht so, dass jede Milliarde, die Herr Mehdorn und die DB bekommen, vernünftig eingesetzt wird. Nach wie vor werden Milliarden beim Ausbau von ultrateuren Hochgeschwindigkeitsstrecken versenkt, obwohl der Nutzen insgesamt bescheiden ist. Auf wenigen Fernverkehrsstrecken wird mit größtem Aufwand die Fahrzeit verkürzt, teilweise sogar zu Lasten der Gesamtgeschwindigkeit im Netz. Manche dieser Hochgeschwindigkeitsstrecken sind nicht einmal nutzbar für Güterverkehr.
Mit Winfried Hermann sprach Hubertus Volmer
Quelle: ntv.de