Zehn Jahre nach PISA Blick in den Unterricht fehlt
24.06.2010, 10:04 Uhr
Die erste PISA-Studie 2000 führte zu einem Schock und zu vielen politischen Bekenntnissen, die Bildung stärker zu fördern.
(Foto: dpa)
Zehn Jahre nach der ersten PISA-Studie liegt ein neuer Leistungsvergleich für Schüler vor. Positiv verändert hat sich kaum etwas. Nach der neuen Untersuchung ist die Abhängigkeit von sozialer Herkunft und Bildungserfolg in Deutschland eher größer als kleiner geworden. "Bildungsreformen brauchen einen langen Atem", sagt Bildungsforscher Klaus Klemm im Interview mit n-tv.de. Er stellt zudem fest: "Die immer neuen Messungen geraten an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit." Im Unterricht selbst sei allerdings "fast gar nichts geschehen".
n-tv.de: Der neue Schulleistungsvergleich offenbart wie die erste PISA-Studie aus dem Jahr 2000 desaströse Ergebnisse. Wieso hat sich in der Zwischenzeit so wenig getan?
Klaus Klemm: Bildungsreformen brauchen einen langen Atem. Die Kinder, die jetzt getestet werden, wurden durch viele der neuen Maßnahmen noch gar nicht erreicht. Wenn zum Beispiel mit der Vorschulerziehung etwas erreicht werden sollte, dann kann man das erst in einigen Jahren messen. Man braucht, um ein neues Auto zu entwickeln, mehrere Jahre. Wieso sollte das in der Schule auf einmal ganz schnell gehen?
Was ist denn bisher geschehen – und was nicht?
In der Tat ist bisher vieles zu spät und insgesamt zu wenig geschehen. Im Bereich Vorschulförderung haben wir wirklich Fortschritte erzielt, in allen Bundesländern. Dagegen haben bundesweit nur etwa 25 Prozent der Schülerinnen und Schüler Plätze in Ganztagsschulen. Das ist sehr wenig, wenn man bedenkt, dass in Frankreich alle Kinder ganztags beschult werden. Die Beschlussrichtung ist hier zwar richtig, aber das Tempo ist viel zu langsam. Außerdem ist im Kerngeschäft der Schule, im Unterricht, bisher fast gar nichts geschehen. Die großen Leistungsstudien messen immer wieder die Ergebnisse der Schüler. Sie beobachten und beschreiben aber nicht, was im Unterricht tatsächlich passiert. Man wird sicher einige Rahmenbedingungen verbessern können, aber wenn man den Unterricht selbst ausspart, werden die Ergebnisse nicht gravierend verändert.
Woran liegt es, dass im Unterricht selbst nichts passiert? Fehlen die Lehrkräfte, gibt es zu wenig Geld für die Schulen?
Wir haben zu wenige Studien, die zeigen, wie der Unterricht zum Beispiel in Brandenburg oder Bayern abläuft, also in Ländern, die bei Tests sehr unterschiedlich abschneiden. Wir wissen deshalb nicht, wie sich der Unterricht unterscheidet. Dadurch ist es auch schwer, über Lehrerbildung oder Änderungen im Unterricht etwas zu bewegen. Das sind Prozesse, die Wissen voraussetzen, das wir nicht haben. Es ist viel weniger aufwendig, Schüler zu testen, als den in einzelnen Ländern praktizierten Unterricht für das jeweilige Land repräsentativ zu beobachten, zu beschreiben, zu analysieren und dann auf eine Verbesserung von Leistungsergebnissen hin auszurichten.
Was bewirken die neuen Bildungsstandards, die die PISA-Kriterien abgelöst haben?
Die neuen Bildungsstandards, auf die sich alle 16 Länder verständigt haben, machen die Schülerleistungen nicht besser. Aber sie legen fest, was ein junger Mensch am Ende einer Klassen- oder Bildungsstufe können sollte. Alle Länder haben ihre Lehrpläne darauf ausgerichtet. Das Ziel ist die Vergleichbarkeit zwischen den Bundesländern. Durch Tests wird dann festgestellt, wie weit die Schüler gekommen sind. Das ist ein sinnvolles Ziel, aber dadurch wird ja kein Schüler besser. Die immer neuen Messungen geraten an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Wir müssen jetzt stärker zur Schulentwicklung und zur Unterrichtsentwicklung kommen.
PISA-Forscher Jürgen Baumert spricht immerhin von einem "Mentalitätswandel in Politik und Gesellschaft", der durch die regelmäßigen Schultests der letzten zehn Jahre ausgelöst wurde. Sehen Sie das ähnlich?
Seit es die PISA-Studien gibt, wird das Thema Bildung in der Tat in ganz anderer Weise in der Öffentlichkeit präsentiert. Die politischen Bekenntnisse, mehr zu tun, sind Legion. Wir haben allerdings auch im kläglichen Scheitern des Bildungsgipfels in diesem Juni erlebt, dass viele Ankündigungen der Politik mehr Lippenbekenntnisse denn Realität sind.
Bei der Vorstellung des aktuellen Bildungsberichts vor einigen Tagen forderten die Wissenschaftler, dass die Bildungsausgaben mindestens erhalten bleiben oder in verschiedenen Bereichen noch erhöht werden müssten. Ist das in Zeiten des Sparens überhaupt machbar?
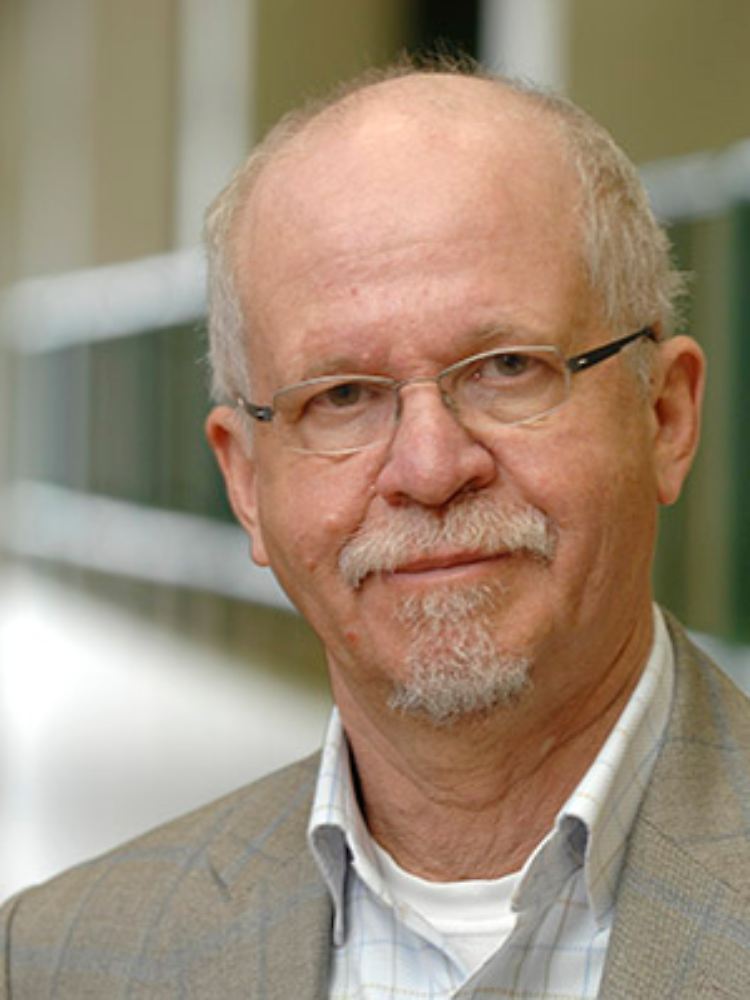
Prof. em. Dr. Klaus Klemm lehrte bis 2007 Bildungswissenschaften an der Universität Duisburg-Essen. Er saß zudem im wissenschaftlichen Beirat der PISA-Studien.
Die Politiker, die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin haben sich 2008 auf dem Dresdner Bildungsgipfel darauf verständigt, die Bildungsausgaben bis 2015 auf zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts anzuheben. Das wäre ein Anstieg um 41 Milliarden Euro. Allerdings war man sich nicht einig, wie man das machen will und wer daran welchen Anteil zu tragen hat. So ist erst mal gar nichts geschehen. Dass die Bildung beim Sparpaket nicht angetastet wurde, ist gut. Aber von einem expansiven Kurs bei den Bildungsausgaben kann keine Rede sein. Und ich erwarte das auch in den nächsten Jahren nicht.
Das Geld ist die eine Seite, das Konzept ist eine andere. Wie sehen Sie zum Beispiel den Volksentscheid in Hamburg am 18. Juli über die Einführung der sechsjährigen Primar- oder Gemeinschaftsschule?
Bei dem Volksentscheid geht es um die Frage, ob unsere Schulstrukturen einer modernen, demokratischen Industriegesellschaft entsprechen. Diese Frage hängt mit der sozialen Selektivität zusammen, aber nicht unbedingt mit den Schulleistungen. Niemand würde sagen, mit der sechsjährigen Grundschule oder der Gemeinschaftsschule allein würden die Leistungen besser. Damit kann man den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Schulerfolg abschwächen, aber es gibt keine belastbaren Forschungen, die zeigen, dass dann die Schulleistungen besser werden. Strukturfragen sind wichtig – aber nicht unbedingt für die Leistungssteigerung.
Sowohl im Bildungsbericht als auch im Schulleistungsvergleich wird gesagt, dass die Abhängigkeit von sozialer Herkunft und Bildungserfolg in Deutschland extrem groß ist. Wo liegen die Fehler, was könnte man besser machen?
Es gibt kein Land auf der Welt, in dem es keinen Zusammenhang zwischen sozialem Hintergrund der Schüler und Schulerfolg gibt. Aber es gibt viele Länder, in denen dieser Zusammenhang deutlich schwächer ist als in Deutschland. Auch im innerdeutschen Vergleich gibt es Länder, in denen der Zusammenhang sehr stark ist, zum Beispiel Bayern, und Länder, in denen er relativ schwach ist, zum Beispiel Berlin. Wir haben da also Spielräume, die nicht ausgenutzt werden. Hier greift die Frage, die auch in Hamburg eine Rolle spielt: Wie früh und nach welchen Kriterien sortieren wir Kinder auf unterschiedlich anspruchsvolle Bildungswege? Je früher wir das machen, umso stärker ist vermutlich die soziale Auslese.
Bildungsministerin Annette Schavan hat kürzlich das Projekt "Bildungsketten" vorgestellt, das Brücken zwischen lerngefährdeten Schülern und Betrieben herstellen und Ausbildungsplätze vermitteln soll. Ist das ein Schritt in die richtige Richtung?
Ich sehe nicht so recht, wie dieses Instrument etwas bringen soll. Es fängt erst nach der Schule an, kann die Leistungen also nicht verbessern. Solange die angebotenen Ausbildungsplätze nicht der Nachfrage entsprechen, können noch so viele "Bildungsketten" keine zusätzlichen Ausbildungsplätze schaffen. Zudem muss man differenzieren: In den neuen Bundesländern herrscht wegen des Geburtenrückgangs bald ein Lehrlingsmangel, im Westen haben wir dagegen zu wenig Ausbildungsplätze. Da hilft es nicht, wenn "Bildungsketten", was immer das im Einzelnen sein mag, den Zusammenhang zwischen Schule und Betrieb stärken. Das führt nur dazu, dass Teilnehmer an diesem Programm Ausbildungsplätze bekommen und dass die leer ausgehen, die nicht daran teilgenommen haben.
Mit Klaus Klemm sprach Markus Lippold
Hier finden Sie den offiziellen Bericht zum Schulleistungsvergleich.
Quelle: ntv.de












