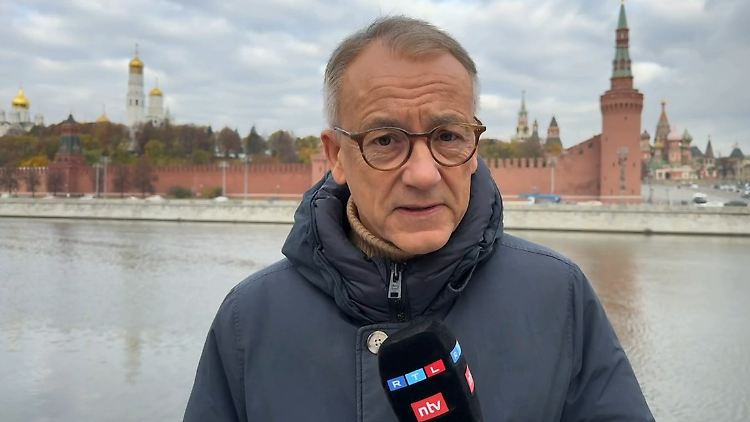"Folterwerkzeug" aus dem Auswärtigen Amt Sparpläne bedrohen Goethe-Institut
02.06.2010, 12:27 Uhr
Außenminister Westerwelle muss sparen.
(Foto: picture alliance / dpa)
Auch die 150 Goethe-Institute weltweit sind vom Sparzwang der Bundesregierung betroffen. Dabei liegt die letzte Krise der Einrichtung nur wenige Jahre zurück.
Das Goethe-Institut gilt als das Flaggschiff der deutschen Kulturpolitik im Ausland, Außenminister Guido Westerwelle sprach gar von einem "Juwel". Doch angesichts der radikalen Sparpläne für den Bundesetat drohen dem Institut massive Einschnitte. Bei der Haushaltsklausur des Kabinetts sollen die Rahmenbedingungen festgezurrt werden.
Das Auswärtige Amt, das dieses Jahr 30 Millionen Euro einsparen muss, will allein dem "Goethe" 10 Millionen streichen. Die Mittel wurden im laufenden Etat bereits gesperrt. Noch schlimmer: Bis zum Jahr 2014 sollen die Verwaltungskosten des Instituts auf dem Stand von 2009 eingefroren werden. Das würde die Programmarbeit drastisch einschränken. Die Kulturpolitiker im Bundestag schlagen Alarm.
Kulturpolitiker schlagen Alarm
"Anderswo geben wir Geld ohne Ende aus", warnt der Vorsitzende des Unterausschusses Auswärtige Kulturpolitik, Peter Gauweiler. "Beim Goethe-Institut ginge es um Einsparungen in der Größenordnung einer besseren Autobahnbrücke - das wäre töricht bis zum Unerträglichen."
Die Pläne aus dem Auswärtigen Amt treffen die Kultureinrichtung besonders hart, weil sie sich gerade erst von einer schweren Krise erholt hat. 2006 stand das Institut praktisch vor dem Ruin, nur eine strikte Strukturreform und ein drastisches Abspecken in der Zentrale in München brachten es wieder auf die Beine. Wichtigste Neuerung: Das Institut bekommt sein Geld seither im Block, kann eigenverantwortlich damit umgehen und seine eigenen Schwerpunkte setzen.
"Uns ist klar, dass jeder einen Sparbeitrag leisten muss", sagt die Vorsitzende im Bundestagskulturausschusses, Monika Grütters. "Aber auch in harten Zeiten sollten wir mühsam erarbeitete Errungenschaften nicht aufs Spiel setzen."
Goethe-Institut hält sich zurück
Die Abgeordneten sind besonders verärgert, dass die geplante Rosskur nicht mit ihnen beraten wurde. Erst nachdem das Goethe-Institut bereits in einem Brief informiert war, berichtete die neue Staatsministerin im Außenamt, Cornelia Pieper, im Parlament hinter verschlossener Tür über die Pläne - die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" machte sie kürzlich publik.
Das Goethe-Institut selbst hält sich in der Debatte auffallend zurück. Man wolle kein Öl ins Feuer gießen, heißt es dort. Dennoch sprach Präsident Klaus-Dieter Lehmann in einem seiner wenigen Interviews von "Folterwerkzeugen" aus dem Auswärtigen Amt.
"Das kann nicht das letzte Wort sein", sagte er. "Wir wollen nicht zu Hausmeistern unserer eigenen Häuser degradiert werden." Das Außenamt verweist im Gegenzug darauf, dass es lediglich um Überlegungen gehe, die Haushaltsgespräche liefen noch.
Beachtliche Erfolge der Einrichtung
Tatsächlich kann das "Goethe" für die vergangenen Jahre beachtliche Erfolge vorweisen: Zwischen 2006 und 2009 wurden immerhin 25 Prozent der Personalkosten eingespart, der Anteil frei verfügbarer Programmgelder stieg von einem Viertel auf ein Drittel des Gesamtbudgets. Und das vergangene Jahr war mit 228 Millionen Euro öffentlichen Zuwendungen und der Rekordzahl von 106 Millionen Euro Eigeneinnahmen das erfolgreichste Jahr in der fast 60-jährigen Goethe-Geschichte.
Aufgabe des Hauses ist es, deutsche Literatur, Musik und Kunst im Ausland bekannt zu machen. Nach Neugründungen in Russland, Asien und Afrika gibt es inzwischen 150 Institute in 84 Ländern. Zahlreiche neue Projekte kommen hinzu: So wird seit 2008 an fast 500 Partnerschulen in aller Welt der Deutschunterricht gefördert, mehrere 10.000 Migranten legten in den deutschen Häusern ihre Sprachprüfungen ab. Und zur Fußball-WM sind zahlreiche Sonderprogramme geplant.
Sie setze darauf, dass es nach der Haushaltsklausur zu "guten Gesprächen" komme, sagte Grütters diplomatisch. "Da muss in einem intensiven Dialog nachgesteuert werden."
Quelle: ntv.de, Nada Weigelt, dpa