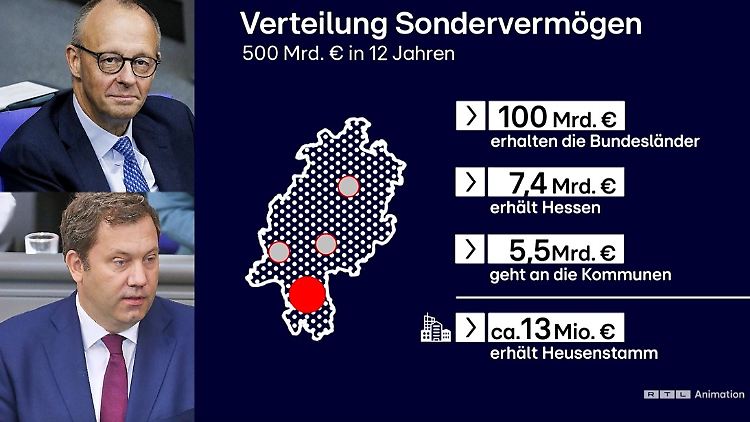Statt "Bildungsherbst" Warten auf den Bildungsfrühling
26.12.2007, 14:47 UhrAufgeschoben ist nicht aufgehoben. Einen "Bildungsherbst" hatte Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU) noch im September angekündigt - mit wegweisenden Beschlüssen des Kabinetts für eine "Nationale Qualifizierungsoffensive" von Bund und Ländern. Doch nach dem Wechsel an der Spitze des Arbeitsministeriums von Franz Müntefering zu Olaf Scholz (beide SPD) wurde die längst fällige Regierungsentscheidung wegen offener Abstimmungsfragen noch kurz vor Weihnachten wieder vertagt. Nun heißt es: Warten auf den deutschen Bildungsfrühling.
Dabei wird für viele Probleme schon seit Jahren nach Lösungen gesucht: Zu viele Schulabbrecher, zu wenig Abiturienten und Hochschulabsolventen - und dies bei einem immer größeren Mangel an Ingenieuren, Informatikern, Ärzten, Lehrern und anderen Akademikern. Migrantenkinder und Schüler aus armen Familien werden nach wie vor unzureichend gefördert. Das deutsche Schulsystem gilt als wenig durchlässig. Die Weiterbildung schwächelt. Und für qualifizierte Berufstätige ohne Abitur bleiben die Tore deutscher Universitäten weitgehend verschlossen - anders als in vielen anderen Industriestaaten.
Der Lösungsdruck wächst
Ein "Bildungsgipfel" von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten sollte nach ursprünglichen Regierungsüberlegungen endlich den Durchbruch bringen. Doch um die auf ihre Kulturhoheit pochenden Ministerpräsidenten nicht schon im Vorfeld zu verprellen, ist der Arbeitstitel für den für Herbst 2008 angestrebten runden Tisch jetzt erst einmal wieder offen.
Gleichwohl wächst der Lösungsdruck. Denn nicht nur die High-Tech-Branche und der boomende Maschinen- und Anlagenbau klagen angesichts unbesetzbarer Stellen heute schon über Milliarden-Einbußen. Der Mangel an Fachkräften - so eine Rechnung aus dem Hause von Wirtschaftsminister Michael Glos (CSU) - koste Deutschland bis zu ein Prozent seines Bruttoinlandsproduktes. Allein für 2007 seien dies mehr als 20 Milliarden Euro.
Dabei gibt es gleich mehrere Reformbaustellen: Nach der aktuellen Kultusminister-Statistik schafften im vergangenem Jahr 7,9 Prozent der Jugendlichen keinen Hauptschulabschluss. Die Arbeitsmarktchancen dieser Jugendlichen sinken weiter. Bis 2020 werden einer Prognose zufolge mindestens weitere 800.000 Stellen für Ungelernte fortfallen.
Unmut über Länder-Versäumnisse
Im gleichen Zeitraum werden aber ein gutes Viertel mehr Akademiker gebraucht als heute. Nach Berechnung des Bundesbildungsministeriums werden allein bis 2014 jährlich 12.000 Ingenieure und 50.000 sonstige Akademiker fehlen. Die OECD stellt fest, dass Deutschland derzeit nicht in der Lage ist, Ingenieure, die in den Ruhestand gehen, durch junge Absolventen zu ersetzen.
Nicht nur im Kanzleramt sondern auch in den Koalitionsfraktionen wächst der Unmut über Länder-Versäumnisse bei der Bildung - obwohl man ihnen mit der Föderalismusreform geradezu die uneingeschränkte Generalvollmacht erteilt hatte. Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion, Norbert Röttgen, will die Schlüsselfrage Bildung nun "jenseits der förderalen Zuständigkeiten" zu einem großen Projekt der zweiten Halbzeit der großen Koalition machen.
Auch Schavan - früher Kultusministerin in Stuttgart - fordert heute bei der Bildung eine "gesamtstaatliche Strategie des Bundes und der Länder". Ihre Warnung nach gut zwei Jahren in Berlin: Wenn sich der Föderalismus als "Kleinstaaterei erweist, fährt er an die Wand".
Anstieg der Studienanfängerzahl hinter den Erwartungen
Dabei hat der Bund in den vergangenen zehn Jahren unabhängig von Zuständigkeitsfragen deutliche Akzente gesetzt und mit Geldspritzen und Gemeinschaftsprogrammen die Länder vorangetrieben - so etwa bei der Vier-Milliarden-Initiative zum Ausbau der Ganztagsschule. Auch die Hochschulen haben außerhalb ihrer regulären Etats von Bund und Ländern noch nie soviel zusätzliches Geld zur Verfügung gehabt wie heute: 1,9 Milliarden Euro aus der Forschungs-Exzellenz-Initiative bis 2010 und weitere 1,8 Milliarden aus dem Hochschulpakt zur Schaffung zusätzlicher Studienplätze.
Doch noch nie war auch die Zahl der Zulassungsbeschränkungen so hoch wie derzeit. Für 59 Prozent aller neuen Bachelor-Studiengänge und für 54 Prozent der klassischen Studiengänge besteht inzwischen ein Numerus Clausus. Der jüngste Anstieg der Studienanfängerzahl um 3,8 Prozent blieb angesichts der Rückgänge in den Jahren zuvor weit hinter den Erwartungen.
Von Karl-Heinz Reith, dpa
Quelle: ntv.de