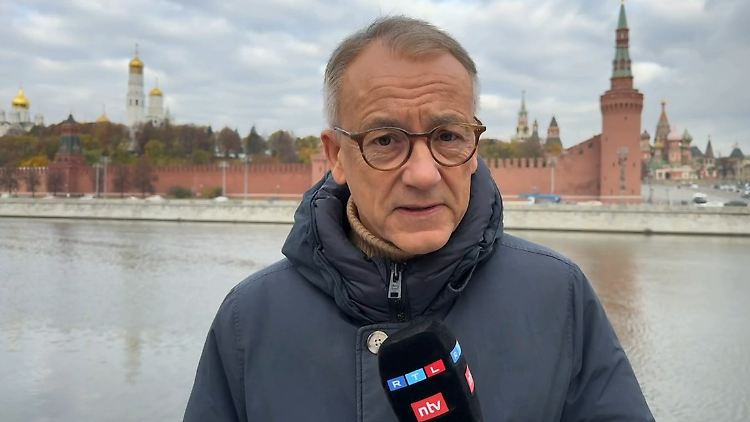Es ist immer gut ... ... einen Vorrat zu haben
07.11.2007, 00:18 UhrEin Anruf beim Arzt, eine E-Mail an einen Kollegen, die SMS eines Bekannten: Die geplante Vorratsspeicherung von Kommunikationsdaten betrifft fast jeden Bürger etliche Male am Tag. Nach dem Willen der großen Koalition sollen Telefon- und Internetanbieter künftig die Verbindungsdaten ihrer Kunden ein halbes Jahr lang speichern. Heute soll der Gesetzentwurf zur Neufassung der Telefonüberwachung und zur vorsorglichen Speicherung von Telefon- und Internetdaten im Justizausschuss des Bundestages beraten werden. Schon am Freitag werden die Parlamentarier voraussichtlich der Änderung zustimmen.
Das Vorhaben ruft scharfe Kritik bei der Opposition und bei Berufsverbänden hervor. Politiker von FDP, Grünen und Linkspartei sowie Anwälte, Ärzte und Journalisten protestierten am Dienstag massiv gegen beide Vorhaben und warnten vor einer Aushöhlung der Grundrechte. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) begrüßte dagegen die Pläne.
Am Dienstagabend gingen tausende Menschen auf die Straße. Nach Angaben des Arbeitskreises Vorratsdatenspeicherung beteiligten sich rund 10.000 Menschen an Demonstrationen in Berlin, Bremen, Augsburg, Hannover, Frankfurt, Stuttgart und anderen Städten.
Alle sind dann betroffen
Obwohl nach dem 11. September 2001 zahlreiche Sicherheitsgesetze verschärft wurden, betrifft kaum eine andere Maßnahme so viele Bürger. Zwar können Behörden schon lange die Kommunikation überwachen und gegebenenfalls sogar E-Mails mitlesen und Telefonate abhören. Doch dies betrifft Verdächtige und ihre mutmaßlichen Kontaktpersonen. Mit der Gesetzesänderung, die zum 1. Januar in Kraft treten soll, werden dagegen Daten von Millionen Bürgern ohne Verdacht vorsorglich gespeichert.
Das Vorhaben von Justizministerin Brigitte Zypries (SPD) stößt deshalb auf Widerstand bei Datenschützern, Bürgerrechtlern und Politikern der Opposition, bei Ärzten, Anwälten und Journalisten. Sie befürchten, dass mit der Vorratsdatenspeicherung der Bürger noch durchsichtiger wird. Die Bundesregierung verweist darauf, dass die Inhalte von Telefonaten, E-Mails oder Kurznachrichten nicht betroffen sind.
Sollte die Regelung wie geplant in Kraft treten, laufen aber schon nach kurzer Zeit gigantische Datenmengen auf: Jedes Telefonat, jede E-Mail, jede Kurznachricht, jeder Zugriff auf das Internet wird protokolliert. Werden Mobiltelefone benutzt, müssen Telekommunikationsfirmen sogar die Orte speichern, in denen sich Anrufer und Angerufener aufhalten. Eine Horrorvorstellung für Bürgerrechtler: "Mit Hilfe der über die gesamte Bevölkerung gespeicherten Daten können Bewegungsprofile erstellt, geschäftliche Kontakte rekonstruiert und Freundschaftsbeziehungen identifiziert werden", befürchtet der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, in dem sich Gegner des Vorhabens organisiert haben.
Gute alte Telefonzelle
Verbindungen erkennen, Profile erstellen - darauf hoffen Behörden bei Ermittlungen gegen Mafia-Kriminalität und Terroristen. In der Diskussion über eine entsprechende EU-Richtlinie hatten sich viele für eine längere Frist als die schließlich vereinbarten sechs Monate ausgesprochen. So plädierte das deutsche Bundeskriminalamt für eine Frist von mindestens einem Jahr, weil Terroristen und kriminelle Organisationen ihre Taten über längere Zeit planten. Kritiker halten dem entgegen, dass Kriminelle die Überwachung leicht umgehen könnten. Telefonzellen zum Beispiel werden von der neuen Regelung nicht erfasst, und auch in Zukunft kann man in Internetcafs anonym kommunizieren. Regelungen, nach denen sich auch Besitzer von Handy-Guthabenkarten ausweisen müssen, gelten zudem nicht unbedingt im Ausland. Mit Hilfe von Roamingabkommen ist damit das anonyme Telefonieren in Deutschland möglich.
Gang nach Karlsruhe vorprogrammiert
Sollte das Gesetz wie geplant verabschiedet werden, könnte sich das Bundesverfassungsgericht damit beschäftigen. Denn Kritiker wie der Bielefelder Rechtsprofessor Christoph Gusy sehen darin das Fernmeldegeheimnis und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung verletzt. Ihre 148 Seiten starke Verfassungsbeschwerde steht bereits ausformuliert im Internet.
Einen Tag vor der Beratung im Bundestags-Justizausschuss forderten Anwälte und Ärzte die Abgeordneten auf, die Vorlage noch zu verändern. Sollte das Gesetz verabschiedet werden, rechnet auch der Präsident des Deutschen Anwaltvereins, Hartmut Kilger, mit einer Klage in Karlsruhe. Der Gesetzentwurf der Regierung ebnet nach seinen Worten weiter den Weg "zu dem Verlust der in einem Rechtsstaat notwendigen Privatheit". Kilger befürchtete zudem, dass mit dem Gesetz die umstrittene Online-Durchsuchung durch die Hintertür eingeführt werden könnte.
Berufsgruppen unter Generalverdacht
Mit dem Gesetzesvorhaben sehen Ärzte und Anwälte ganze Berufsgruppen unter einen Generalverdacht gestellt. Der Vorsitzende des Marburger Bundes, Frank Ulrich Montgomery, warnte vor einer totalen Aushöhlung der ärztlichen Schweigepflicht, wenn der Patient damit rechnen müsse, in der Arztpraxis abgehört zu werden. Die Ärzte lebten davon, dass die Patienten ihnen alles vertrauen könnten, was zur Behandlung nötig sei. Dieses Recht gelte auch für Strafgefangene.
Ärzte und Anwälte protestierten auch gegen die unterschiedliche Einstufung von Berufsgeheimnis-Trägern. Kilger sprach von einem nicht zu rechtfertigenden Zwei-Klassen-System. Nach dem Gesetzentwurf erhalten Geistliche, Strafverteidiger und Abgeordnete einen absoluten Schutz, andere Gruppen wie Ärzte, Journalisten und die übrigen Anwälte einen relativen Schutz. Maßnahmen gegen diese Gruppen sind nur nach Abwägung der Verhältnismäßigkeit zulässig.
Überwachungsstaat wird zementiert
Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) warnte vor katastrophalen Folgen für die Pressefreiheit. DJV-Vorsitzende Michael Konken sagte, Journalisten könnten künftig nicht mehr frei und unabhängig mit Informanten sprechen. Besonders mit Informationen von Behördenmitarbeitern seien Skandale aufgedeckt worden. "Gerade mit solchen Maßnahmen soll so was künftig verhindert werden." In den vergangenen Jahren hätten die staatlichen Eingriffe in die Pressefreiheit "beängstigend zugenommen". Der Staat gehe "immer rigoroser" damit um. Die Begründung der Politik für die Verschärfung der Gesetze - den Kampf gegen den Terrorismus - halte er für vorgeschoben. Es gebe bereits den Überwachungsstaat: "Der wird jetzt nur noch gesetzlich zementiert."
Kein Grund zur Eile
Kilger sagte, es sei zweifelhaft, ob die zugrundeliegende EU-Richtlinie überhaupt wirksam sei. Er verwies auf die Klage Irlands vor dem Europäischen Gerichtshofs. Auch Grünen-Fraktionschefin Renate Künast verwies auf die Nichtigkeitsklage Irlands; deshalb gebe es keinen Grund, die entsprechende EU-Richtlinie jetzt umzusetzen.
Quelle: ntv.de