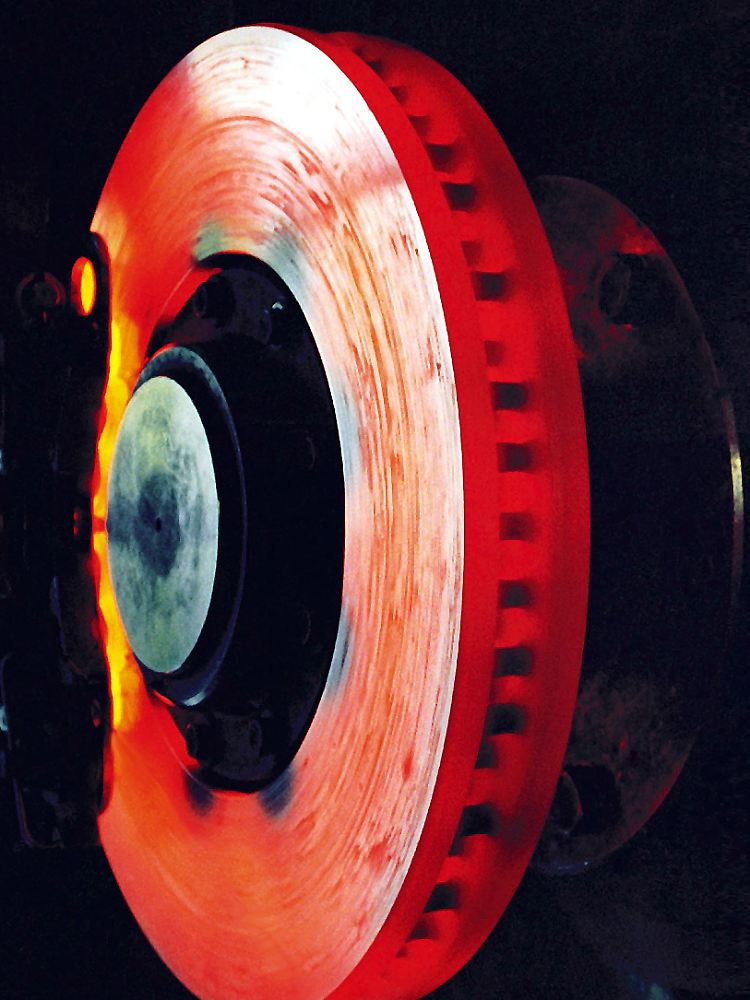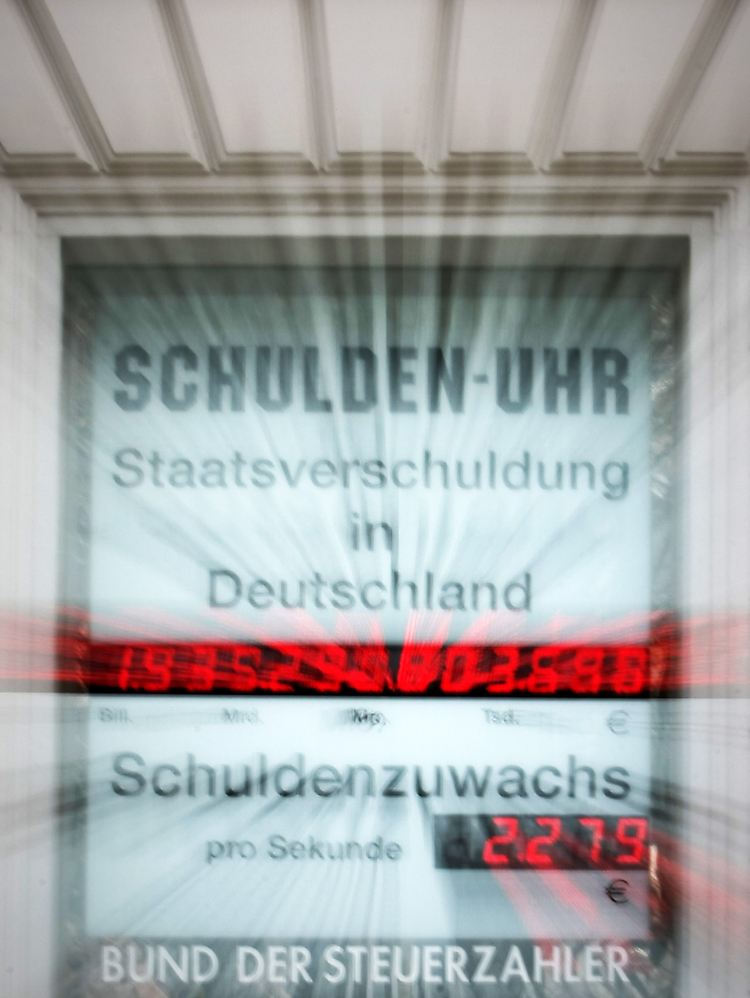Die Mischung macht's Bremsen ohne Quietschen
12.05.2011, 13:34 UhrDie Steuermehreinnahmen lassen Rufe nach Steuererleichterungen laut werden. Aber es gibt nichts zu verteilen. Deutschland fährt mit angezogener Schuldenbremse. Kann das funktionieren? Vielleicht. Die Regierung muss die Weichen stellen. Leider könnte das für den Steuerzahler aber teurer werden.
Es ist immer das gleiche Lied: Kaum hören die Menschen "mehr", wollen sie auch "mehr". So leicht ist es aber nicht in Zeiten der Schuldenbremse. Selbst ein in Deutschland, wie jetzt vom Arbeitskreis Steuerschätzung attestiert, bedeutet nicht automatisch, dass es auch mehr an die deutschen Bürger zu verteilen gibt. Leider.
Schuld ist und bleibt die Tatsache, dass nicht nur Griechenland, Portugal und Co. über ihre Verhältnisse gelebt haben. Nein, auch Deutschland ist dummerweise kein Musterschüler, wenn es um Haushaltsführung geht. Mit einer Staatsverschuldung von 83,2 Prozent liegt Deutschland in der Eurozone genau in der Mitte zwischen Estland (6,6) und Griechenland (142,8). Ein typischer Fall von halb voll oder halb leer. Es liegt ganz im Auge des Betrachters.
Wie leer das Glas in Wirklichkeit ist, sieht man, wenn man sich vor Augen führt, wie viel das "Mehr" eigentlich ist. Wir sprechen für den Zeitraum bis 2014 von voraussichtlich 66,4 Milliarden Euro mehr Steuern für den Bund. Davon sind 53 Milliarden aber bereits verplant. Der Spielraum ist also schon viel kleiner als vielfach gedacht. In Zahlen ausgedrückt reden wir von 13 Milliarden Euro. Das ist – um es auf den Prozentpunkt zu bringen - weniger als ein Prozent des BIP. Gibt es da etwas zu verteilen? Vor allem Geld, das noch gar nicht eingenommen wurde? Eher weniger.
Rühren oder Schütteln?
Die Schuldenbremse besagt, dass die Haushalte von Bund und Ländern ab 2020 grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auskommen müssen. Die Schuldenbremse ist im Grundgesetz verankert, also bindend. In den kommenden neun Jahren müssen die Haushaltsausgaben also sukzessive zurückgefahren werden. Und es liegt an dieser Bundesregierung und ihren möglichen Nachfolgerinnen, hierfür die richtigen Weichen zu stellen.
Nur - welche Richtung sollen sie einschlagen? An welchen Stellschrauben drehen, um die Vorgaben der Schuldenbremse zu erfüllen? Sollte mehr gespart werden, sollten die Steuern erhöht werden oder gar im Namen von mehr Wachstum gesenkt werden? Wie kann vor allem das Wachstum gestärkt werden? Denn insbesondere mehr Wachstum würde deutlich helfen. Ein Patentrezept gibt es nicht. Alles, was ausgewiesene Steuer-Experten anzubieten haben, sind Mixturen. Auf die richtige Dosierung kommt es offenbar an.
Steuersenkungen, um das Wirtschaftswachstum zu stimulieren, werden kritisiert, weil sie die Einnahmeseite schwächen würden. Das ist in der Tat keine gute Idee. Auch, wenn es die Steuerzahler von heute vielleicht verdient hätten, muss an zukünftige Generationen gedacht werden. Denn Schulden verschwinden nicht einfach so. Es wären unsere Nachfahren, die das "Mehr" an finanzieller Last zu tragen hätten.
Sollte von der Steuerseite alles so bleiben, wie es ist? Auch nicht. Das Steuersystem hat dringenden Reformbedarf. Hierin ist man sich parteienübergreifend einig. Die reduzierte Mehrwertsteuer ist ein Flop. Selbst die Übernachtungswirtschaft, die dank überzeugender Lobbyarbeit bei der Regierung punkten konnte, erkennt an, dass der Schuss nach hinten losgegangen ist. Der Mittelstand hat einen "dicken Bauch", und zwar nicht nur einen dicken Steuerbauch, sondern zusätzlich einen dicken Sozialabgabenbauch. Die Belastung müsste also dringend gesenkt werden. Passiert ist bislang nichts. Also ginge noch etwas, zumindest in Form von Umverteilung.
Mehr als ein Wermutstropfen
Bleibt radikales Sparen. Aber auch das ist für sich genommen kein Allheilmittel. Der Vergleich zu Griechenland drängt sich auf. Was würde passieren, wenn wir den Gürtel so eng schnallten, wie das klamme Südland? Große Überraschung: In dem Umfang, wie in Griechenland gespart wird, würde das Gleiche in Deutschland passieren wie dort. Die Sparmaßnahmen würden das Wirtschaftswachstum abwürgen. Das Bruttoinlandsprodukt würde schrumpfen und damit der Schuldenstand noch weiter steigen. Ein Zuviel ist eben Zuviel. Aber wie viel ist zu viel? Was geht im Fall von Deutschland noch? Rein wissenschaftlich liegt die Grenze, ab der Wachstum durch zu hohe Staatschulden und dadurch verursachte Zinszahlungen und Investitionskürzungen abgewürgt wird, irgendwo zwischen 60 und 90 Prozent des BIPs. Deutschland lag zuletzt bei gut 83 Prozent. Wir befinden uns also bereits tief im kritischen Bereich. Da dürfte also wohl nur noch auf dem Reißbrett etwas gehen.
Fest steht: Das oberste Ziel muss sein, dass Deutschland möglichst auf einem starken Wachstumspfad bleibt. Und dafür braucht es in den nächsten Jahren ein Mehr an Investitionen. Wohl sortiert und wohl dosiert. Vor allem Infrastruktur und Bildung stehen oben auf der Liste. Denn diese Investitionen zahlen sich in der Folgezeit überproportional gut aus.
Aber sollen tatsächlich Lücken geschlossen werden, müssen Steuern möglicherweise – und das tut weh - sogar erhöht werden, um die Einnahmeseite zu stärken, und nicht, wie viele es sich jetzt wünschen, Steuern gesenkt werden. Mehr Möglichkeiten gibt es nicht.
Auf die Mischung kommt es eben an. Vielleicht ist das Sahnehäubchen noch ein Mehr an Inflation – frei nach dem US-amerikanischen Modell. Was scheren uns unsere Schulden, wenn sie nichts mehr wert sind. Mehr geht dann wirklich nicht mehr.
Quelle: ntv.de