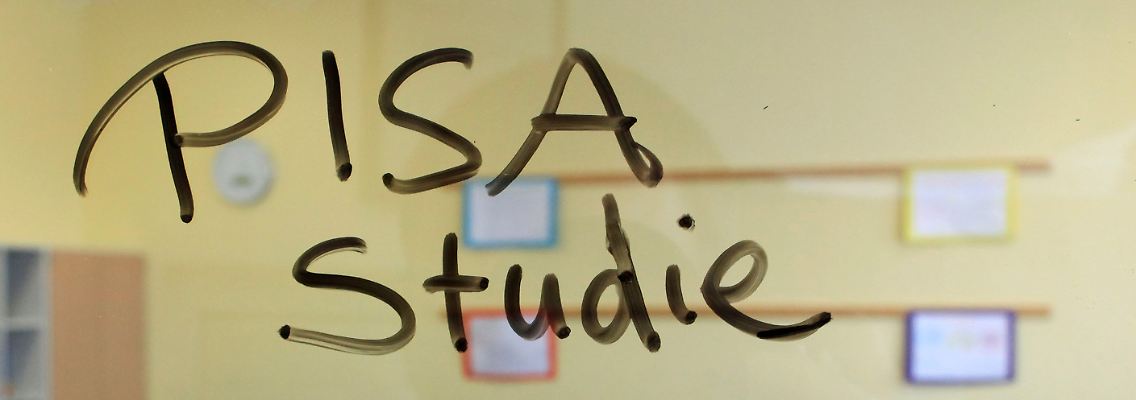Deutschland im Pisa-Mittelmaß Bildungskasernen dürfen kein Vorbild sein
07.12.2010, 22:19 UhrKnapp zehn Jahre nach dem Pisa-Schock haben sich klar verbessert. Im Lesen sind die Schüler allerdings im internationalen Vergleich weiter nur mittelmäßig. Die Presse sieht denn auch noch jede Menge Baustellen, gibt aber zu bedenken, dass sich das asiatische Modell kaum zur Nachahmung empfiehlt.
Die Märkische Allgemeine erinnert daran, dass die erste Pisa-Studie Deutschland erschüttert hat. "Zehn Jahre danach haben sich die deutschen Schüler tatsächlich verbessert. Dennoch können Kinder im Land der Dichter und Denker nach wie vor nur mittelmäßig Texte lesen und analysieren." Mehr sei aber auch nicht zu erwarten gewesen. Der Pisa-Schock habe sich dennoch als heilsam erwiesen. "Das Thema Bildung genießt viel mehr Aufmerksamkeit als noch vor zehn Jahren. Allein dafür war Pisa hilfreich."
Auch n-tv.de sieht . Doch Deutschland müsse erheblich mehr "in seine Schulen investieren, in die Lehrerausbildung, Weiterbildungen, die Schaffung kleiner Klassen, gutes Schulmaterial." Denn letztlich lohne sich die " Bildung seiner Bürger langfristig für eine Volkswirtschaft. Und für jeden Einzelnen."
Das Flensburger Tageblatt gibt zu bedenken, dass ohne gute Lehrer alle Reformen, alle pädagogischen Konzepte zum Scheitern verurteilt sind. "Trotz der steten qualitativen Verbesserungen in der Lehrerausbildung scheint es aber einen grundlegenden Fehler im System zu geben. Anders ist es nicht zu erklären, dass ungeeignete Kandidaten weder im Studium noch in der Referendariatszeit fast nie durchs Rost fallen. Steht ein Lehrer erst einmal vor einer Klasse, tut er das meist ein ganzes Berufsleben lang. Eine regelmäßige Überprüfung seiner Leistungen findet nicht statt. Warum eigentlich nicht?"
"Noch immer entscheiden hierzulande vor allem das Umfeld und die soziale Herkunft über den Schulerfolg", konstatiert Der neue Tag aus Weiden. "In keinem anderen Land hat ein sozial ungünstiges Schulumfeld einen derart starken Einfluss auf die Leistungen von Kindern aus sozial schwachen Familien. Ein Armutszeugnis für eine der reichsten Industrienationen. Zumal die Mahnung keineswegs neu ist, sondern bereits 2001 so zu lesen war."
Die Frankfurter Rundschau will die aktuelle Bildungsdebatte allerdings nicht nur aufs Geld reduziert sehen. "weil anders als beim Brot ein schlichtes Mehr bei der Verteilung von Bildung keine positive Wirkung garantiert. Wer keinen Hunger auf Wissen verspürt oder niemals gelernt hat, wie man ihn richtig stillt, der wird selbst dann nicht fett, wenn Bildung in Hülle und Fülle fließt."
Die Stuttgarter Zeitung erhofft sich von den etwas besseren Ergebnissen eine Linderung der "hysterischen Auswüchse, die auf Pisa I folgten. Etwas mehr Gelassenheit und Ruhe an den Schulen tut Not. Kinder sind keine Maschinen, bei denen man zur Leistungssteigerung nur mal eben an dieser oder jener Schraube drehen muss." Im Rückschluss auf die aktuellen Sieger Südkorea und China betont das Blatt aber: "Die Bildungskasernen, in denen Kinder in asiatischen Ländern auf Hochleistung gedrillt werden, dürfen jedenfalls kein Vorbild sein."
"Unsere Kinder müssen später auf dem internationalen Markt mit den besser platzierten Chinesen oder Südkoreanern konkurrieren", schreibt die Augsburger Allgemeine. "Dort werden die Jugendlichen durch die Schule gepaukt. Doch diese Länder taugen nicht zu Vorbildern. Bildung sollte uns dafür zu kostbar sein."
Letzten Endes müssen auch Väter und Mütter ihren Beitrag dazu leisten, "dass die Situation an den Schulen besser wird", fordert die in Hannover erscheinende Neue Presse. "Was würde es Kindern und Lehrern helfen, wenn die Eltern mal den Fernseher auslassen und stattdessen ihrem Nachwuchs ein Buch vorlesen würden. Deutschland würde einen großen Sprung nach vorne machen nicht nur bei der nächsten Pisa-Studie."
So sehen es auch die Nürnberger Nachrichten. Natürlich müsse die Schwäche im Lesen Thema für die Schulen sein. "Zuvor aber müssen sich Eltern fragen, ob nicht zuallererst sie dafür zuständig sind. Wer es versäumt, seinen Kindern in zartem Alter aus Büchern vorzulesen, muss sich nicht wundern, wenn sie diese Kulturtechnik später nicht recht schätzen."
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung geht noch eine Schritt weiter "An den geringen Fortschritten bei der Lesefähigkeit zeigt sich zwar, dass die Schule gegenüber wenig lesefreundlichen Elternhäusern, auf deren Mitwirkung sie dringend angewiesen wäre, nahezu hilflos ist. Gleichzeitig aber hat sich in Deutschland eine aktionistische Sprachförderung vom Kindergarten bis zur Grundschule mit unterschiedlichsten Programmen entwickelt, deren Wirksamkeit völlig ungewiss ist." Gefordert sei deshalb nicht nur Sprach- und Leseförderung, sondern auch Unterrichts- und Bildungsforschung.
Quelle: ntv.de, zusammengestellt von Solveig Bach