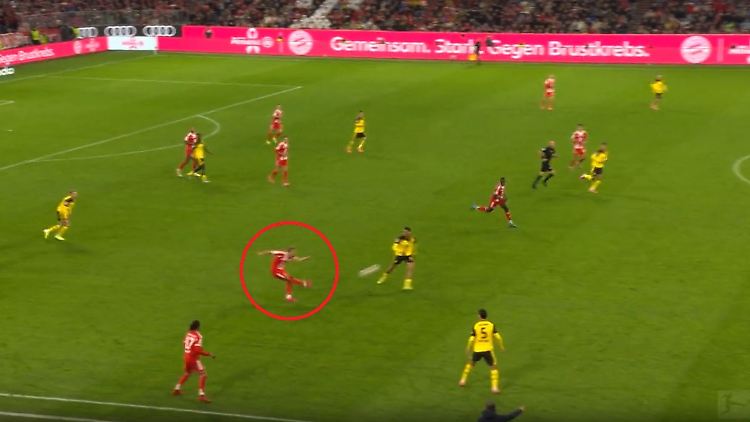Medaillenjagd in Vancouver Materialschlacht mit Millionen
11.02.2010, 15:51 UhrIn Vancouver entscheidet nicht allein die Form der Athleten über Olympia-Sieg oder Niederlage, zentral ist längst das Material. Beim deutschen Team hat man vorab nicht mit Steuergeldern gespart, in Labors getüftelt, im Windkanal getestet, am Computer simuliert. Angeblich flossen seit 2008 rund 24 Millionen Euro in die technische Olympia-Vorbereitung. Bei manchem Konkurrenten führt das zu Verdruss.
Kurz vor dem Startschuss der Winterspiele in Vancouver wird die Konkurrenz offenbar nervös. Der Kanadier Jeff Pain verbreitete Gerüchte über angebliche Manipulationen bei deutschen Skeleton-Schlitten, die mit Magneten ausgestattet sein sollen. Alles nur heiße Luft, beschwichtigten die Deutschen. Doch das Beispiel macht deutlich: Talent allein reicht schon lange nicht mehr aus. Die Medaillenjagd, die in Vancouver wieder auf Platz eins der Nationenwertung enden soll, ist längst zur Materialschlacht geworden.
Auf der Suche nach dem entscheidenden Vorsprung in Vancouver investierte das Bundesinnenministerium allein in den vergangenen zwei Jahren knapp 24 Millionen Euro in die sportwissenschaftliche Forschung. Wie viel Prozent die Technik mittlerweile am Erfolg ausmacht, darauf antworten die Wissenschaftler nicht gerne.
"Es ist ein System mit vielen kleinen Bausteinen, die alle passen müssen. Aber klar ist: Wer schlechtes Material hat, der hat kaum eine Chance", sagt Harald Schaale, Direktor des Instituts für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten (FES) in Berlin. Das FES und das Institut für Angewandte Trainingswissenschaft (IAT) in Leipzig werden aus Steuergeldern finanziert und gelten seit Jahrzehnten als deutsche Goldschmieden. Obwohl ihr Know-How weltweit gefragt ist, dürfen beide Einrichtungen ausschließlich mit deutschen Athleten zusammenarbeiten. Und diese sind ziemlich anspruchsvoll.
90.000 Euro für einen Bob

Ein hochmoderner Viererbob kostet rund 90.000 Euro. Ist es Zufall, dass die Deutschen in teuren Sportarten wie Bob und Rodeln dominieren?
(Foto: dpa)
"Wenn man sich auf den Schlitten packt, muss es sich anfühlen, als wenn man im Wohnzimmer vor dem Fernseher liegt", sagte zum Beispiel Skeleton-Fahrerin Kerstin Szymkowiak kürzlich der "Sport Bild". Um den Sportlern ein angenehmes Fahrgefühl zu ermöglich, werden sogar deren Rippenbögen vermessen.
Das Königsgerät ist unter den Technikern allerdings der Bob. Der Vierer kostet auf dem freien Markt bis zu 90.000 Euro. Für den neuen 407, den der dreimalige Olympiasieger Andre Lange steuern wird, verspricht das FES einen Zeitgewinn von zwei Zehntelsekunden. Der Druck ist groß, denn in den vergangenen zwei Jahren war Kritik an den FES-Bobs laut geworden, viele Fahrer stiegen zwischenzeitlich auf den Konkurrenzbob "Singer" um.
Doch nicht nur im Eiskanal spielt die Technik eine große Rolle. Die Biathleten beispielsweise sind ihre Wettkampfstrecke in Whistler bereits unzählige Male abgelaufen - in Deutschland, auf dem Laufband, mit Skirollern. Ein Computer programmierte dank der mit Videokameras und GPS-System eringesammelten Daten ein genaues Profil der Originalstrecke.
Windkanal als Wundermittel
Die Skispringer dagegen setzen auch auf das Training im Windkanal, der ihnen von ihrem Auto-Sponsor zur Verfügung gestellt wird. "Das ist ähnlich wie bei einer Schanze, aber man kann mit der Luft spielen und hat mehr Zeit", sagte Martin Schmitt.

Damit der Sprung möglichst weit geht, haben die deutschen Skispringer Stunden im Windkanal verbracht.
(Foto: REUTERS)
Auch die alpinen Skistars um Maria Riesch nutzten den Windkanal, um etwa die optimale Abfahrtshaltung herauszufinden. Rieschs Freundin und Dauerrivalin Lindsey Vonn aus den USA schwört dagegen auf ihren Männerski. "Neben ihrem Ski sieht meiner aus wie ein Kinderski", sagte Riesch und meinte angesichts der schwer steuerbaren Bretter: "Auf so etwas stell' ich mich nicht!"
Quelle: ntv.de, Jörg Soldwisch, sid