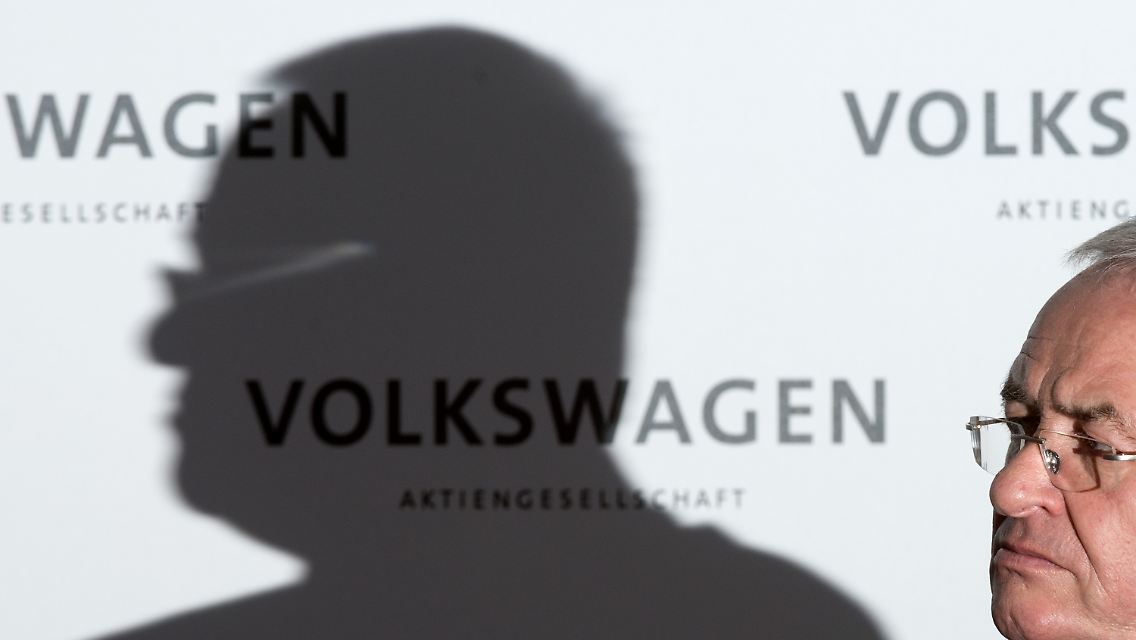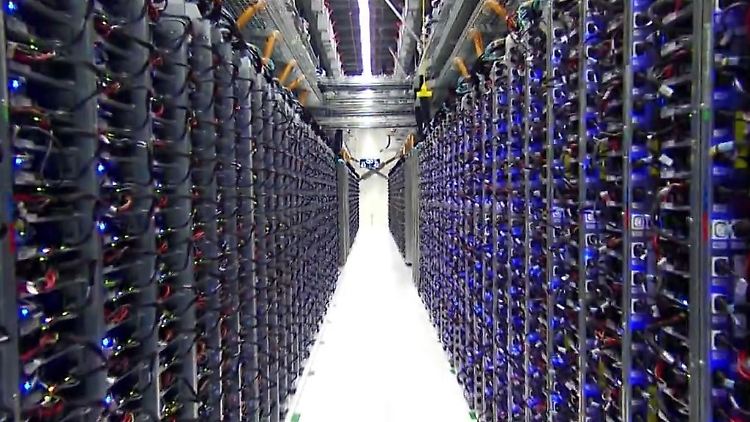Ein Besuch auf dem Auto-Friedhof Braucht die Welt Borgward?
27.04.2015, 10:18 Uhr
Wurde bis 1962 gebaut: Borgward Isabella TS
(Foto: picture alliance / dpa)
Borgward Isabella fährt, wer etwas auf sich hält - zumindest in der Wirtschaftswunderzeit. So steil der Aufstieg des Bremer Unternehmens, so schnell der tiefe Fall. Konkurs. Nun soll die Marke wiederbelebt werden. Aber warum eigentlich?
"Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun." (Albert Einstein). Genutzt hat diese weise Einsicht wenig, zumindest nicht in der Autoindustrie. Denn dort wird hartnäckig immer wieder versucht, die Gesetze des Marktes auszuhebeln, die da lauten: In gesättigten Automärkten mit nur noch einer Handvoll in etwa gleichstarker Hersteller führt jede Art von aggressiver Angebots- und Verkaufspolitik zwangsläufig zu ruinösem Wettbewerb wegen gleichartiger Abwehrreaktionen der Konkurrenten. Der Marktzutritt von Außenseitern mit einer neuen Automarke kommt einem Himmelsfahrtskommando gleich. Und wird nur von Investoren gewagt, die entweder vom Markt oder der neuen Marke oder von beidem keine Ahnung haben.

Helmut Becker schreibt als anerkannter Autoexperte und Volkswirt für teleboerse.de und n-tv.de eine monatliche Kolumne rund um den Automarkt.
Der Reihe nach: Das beste Beispiel für ruinösen Wettbewerb auf einem gesättigten Automarkt wurde in den Jahren 2004 bis 2007 in den USA geboten, wo sich die "Big Three" bei stagnierendem Gesamtmarkt durch exzessive Rabattschlachten zuerst in die roten Zahlen, danach in den Ruin trieben. Heute ist die Situation auf den gesamten westlichen Automobilmärkten ähnlich. Alle verbliebenen Hersteller sind dabei, nicht nur den bösen Wettbewerbern, sondern über zunehmenden Kannibalismus zwischen den eigenen Marken und Modellreihen auch sich selber langfristig den Garaus zu machen. Das geschieht etwa durch eine nimmer enden wollende Ausweitung und Ausdifferenzierung ihrer Modellpaletten durch Derivate und von ihnen selbst als neu entdeckte Segmente und Marktnischen.
Modelle und -varianten satt
Bestes Beispiel für Markenkannibalismus ist der VW-Konzern. Aber auch die Modellvarianten-Explosion bei den deutschen Premiumherstellernführt zwangsläufig zur Kannibalisierung innerhalb der eigenen Modellpalette und nicht nur, wie gewünscht, zur Eroberung beim Wettbewerb. Nur als Beleg: 1990 waren in Deutschland rund 100 Fahrzeugtypen im Händlerangebot, 2014 waren es schon mehr als 450.
In immer kürzeren Abständen erzwingt der Wettbewerb neue Modelle, kämpfen die Hersteller mit ständig neuen Varianten, Ablegern und Typen um die Gunst einer immer aufgeklärter und kritischer werdenden Kundschaft. Modellvielfalt und Ausstattungsvarianten ufern aus. Bei VW gibt es mehr Außenspiegelvarianten als Modelle. Standen bei BMW den Käufern 1990 der Unternehmensberatung Progenium zufolge bei der 3er-Limousine noch 70 verschiedene Varianten zur Auswahl, hat sich diese Zahl mittlerweile auf 215 erhöht. Nach Aussagen des BMW-Vorstands könnte der Konzern heute sogar über drei Millionen Automobile bauen, ohne dass sich einen Ausstattungsvariante wiederholen würde. Bei Audi und Daimler dürften die Dinge nicht groß anders liegen.
Kosten rauf, Margen runter
Dass die deutsche Automobilindustrie eine solche Komplexität in Produktion und Logistik überhaupt beherrscht, verdient Respekt und Hochachtung. Da wird der Wettbewerb aus China oder sonstwoher lange hinarbeiten müssen, um diesen Stand zu erreichen! Andererseits ist aber auch sicher, dass in einem gesättigten Markt zwangsläufig die Absatzzahlen neuer Modellreihe schrumpfen. Am Ende der ausufernden Produkt- und Modellexplosion bei den deutschen Herstellern stehen eine ebenso gnadenlose Explosion der Entwicklungs-, Logistik- und Vertriebskosten und damit am Ende zwangsläufig schrumpfenden Gewinnmargen, wenn die erhofften Marktanteilsgewinne ausbleiben.
Was folgt, ist klar: Früher oder später müssen die schwächeren Hersteller den Markt räumen. So war das auch nach der Wirtschaftskrise 2008. Saab, Volvo, Lancia, Chrysler - alle als Pleite-Unternehmen entweder verschwunden oder von anderen, meist chinesischen Autofirmen übernommen. General Motors im Sanierungskonkurs und nur mit staatlicher Hilfe gerettet - genauso Opel, chronischer Verlustbringer und nur überlebensfähig durch den Liquiditätstropf der Mutter GM.
Zenit erreicht
Deutlicher als mit dieser Variantenpolitik zur Erschließung auch noch der letzten Marktnischen kann eine Branche nicht signalisieren, dass der Zenit der Innovationsentwicklung und des Wachstums erreicht sind. Automobile müssen nicht noch schneller werden, mehr PS und eine bessere Kurvenlage haben oder noch sicherer oder komfortabler werden, als sie ohnehin schon sind. Die Rahmenbedingungen auf Straße und im Verkehr lassen große Innovationssprünge auf diesen Feldern kaum noch zu. Und da, wo man tatsächlich noch Innovationen braucht, nämlich bei der Reduzierung des Verbrauchs oder beim Übergang zu einer CO2-ärmeren Antriebstechnik, tun sich alle Hersteller schwer.
Borgward: Traum oder Albtraum?
Und nun zu Fall zwei, dem Marktzutritt einer neuen Automarke, eines neuen Herstellers oder der Wiederbelebung einer Alt-Marke, die kaum einer mehr kennt und an die sich allenfalls noch deutsche Pensionäre und heute langjährige Audi-, BMW- und Daimler-Fahrer erinnern können: Es geht um die Marke Borgward.
Die Ausgangslage 2015 ist eindeutig: Die Lage der Weltautomobilindustrie in den großen Industrieländern auf der nördlichen Halbkugel ist gekennzeichnet durch große strukturelle Überkapazitäten bei allen Massenherstellern sowie einen gnadenlosen Verdrängungswettbewerb auf allen Wertschöpfungsstufen der Branche. Und in diese Marktsituation platzte auf dem Genfer Automobilsalon mitten zwischen PS-geladenen Superboliden und futuristische Designstudien die Meldung, dass die Marke Borgward kurz vor der Auferstehung steht. Der Enkel des Firmengründers Christian Borgward wollte sich mit dem Comeback einen Traum erfüllen.
Borgward als Automarke war im Wirtschaftswunderland Deutschland ohne Zweifel ein hoch respektiertes Mitglied der automobilen Oberklasse, so wie der VW-Käfer das Auto des kleinen Mannes repräsentierte. Selbst als die Firma mitten im Autoboom 1961 in Konkurs ging, nicht wegen schlechter Autos, nein, infolge kaufmännischer Fehler, blieben viele Prominente aus Film, Funk und Fernsehen bis in die jüngste Vergangenheit bekennende Borgward-Anhänger - wenn sie denn nicht gestorben sind.
Wiederauferstehung einer Uralt-Marke
Und jetzt die Wiederauferstehung dieser Uralt-Marke für ein Käuferpublikum, das es kaum noch gibt. Da nimmt es nicht wunder, dass auf dem Genfer Salon zunächst als Versuchsballon nur das alte Premiummodell Isabella mit neuem Logo des chinesischen Eigentümers gezeigt wurde und man ansonsten auf die IAA 2015 im Herbst vertröstete. Dort soll dann ein neuer Borgward das Licht der Welt erblicken, aber nicht mehr als "Isabella reloaded", sondern als Borgward -SUV. Damit steht der Name für ein Auto, das es in den goldenen 1950ern nie gegeben hat. Um das zu erreichen, sollen in ein neues Hauptquartier in Stuttgart 250 Millionen Euro investiert werden. Nur am Rande: Bei BMW oder Daimler gäbe es dafür nur einen halben Vorder- oder Hinterwagen - wenn überhaupt.
Wie dem auch sei, die Hoffnung stirbt zuletzt. Automobilstrategen können diesen Comeback-Versuch unter dem Namen Borgward nach 50 Jahren Abwesenheit nur milde belächeln. Die Zeit ist über solche Automobillegenden, zu denen auch Bugatti, Maybach oder Horch gehören, hinweggefegt - wenn sie nicht, wie bei BMW und Daimler, fortlaufend aufgefrischt werden. Aber lassen wir noch einmal Einstein zu Wort kommen: "Der dumme Mensch macht den selben Fehler immer wieder, der kluge macht immer wieder neue." Rechnen wir den Wiederbelebungsversuch von Borgward der letzten Kategorie zu.
Quelle: ntv.de