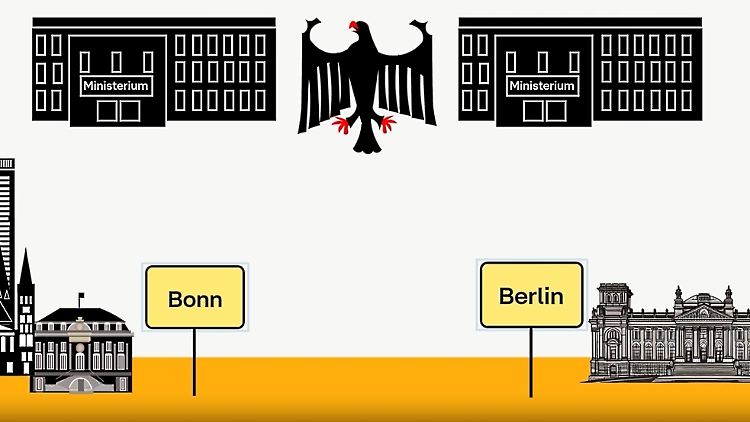Hohe Überkapazitäten DIW sieht keine Gefahr von Stromausfällen
27.11.2013, 17:17 Uhr
Die Kapazitäten reichen aus, die Stromversorgung bis 2020 zu sichern.
(Foto: picture alliance / dpa)
Es ist ein wiederkehrendes Szenario: Die Umstellung auf Erneuerbare Energien gefährdet die Versorgungssicherheit. Das sehen die DIW-Experten anders. Bis 2020 passiere erst einmal gar nichts. Ab dann aber bräuchte es neue Kraftwerke.
Verbraucher müssen sich nach Ansicht von Experten in den kommenden zehn Jahren in keiner Region Deutschlands Angst vor Stromausfällen haben. Noch gebe es bei der Erzeugung hohe Überkapazitäten, heißt es in einer Analyse des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Diese belaufe sich auf etwa rund zehn Gigawatt - dies entspreche etwa der gesamten Kapazität der noch stillzulegenden Atomkraftwerke.
Der Strombedarf könne auch bei ungünstigen Szenarien wie wenig Wind gedeckt werden, hieß es. Erst ab 2020, wenn die letzten Atomkraftwerke und alte Kohlemeiler vom Netz gehen, müssten verstärkt Gaskraftwerke eingesetzt werden, sagte DIW-Energieexpertin Claudia Kemfert in Berlin.
Wegen der schrittweisen Umstellung auf Strom aus erneuerbaren Quellen wie Wind und Sonne wird darüber diskutiert, ob Deutschland schon bald zu wenig Grundlast für eine jederzeit stabile Versorgung haben könnte. "Unsere Modellrechnungen zeigen, dass das Stromsystem selbst bei pessimistischen Annahmen auch weiterhin sicher ist", sagte DIW-Forschungsdirektor Christian von Hirschhausen.
"Kapazitätsmarkt" wenig sinnvoll
Das Institut hält es deshalb weder für notwendig noch für sinnvoll, einen in der Branche diskutierten sogenannten Kapazitätsmarkt einzuführen. Dabei würden Kraftwerke nicht nur Einnahmen für den erzeugten Strom erhalten, sondern auch für die Bereitstellung einer Erzeugungsleistung, die bei Bedarf abgerufen werden kann.
Ein solcher Markt würde nach DIW-Berechnungen die Verbraucherpreise nach oben treiben. Für die Betreiber konventioneller Kraftwerke ergäben sich Mitnahmeeffekte, also Gewinne aus dem Handel mit Zertifikaten, ohne dass tatsächlich Strom produziert werden müsste.
Das DIW schlägt stattdessen eine strategische Reserve vor. Darunter versteht es eine zentral festgelegte Reservekapazität. Sie würde unter öffentlicher Aufsicht von den Stromnetzbetreibern ausgeschrieben. Die Reservekraftwerke sollen nur dann stundenweise zum Einsatz kommen, wenn Nachfrage und Preis besonders hoch sind.
Quelle: ntv.de, jwu/dpa