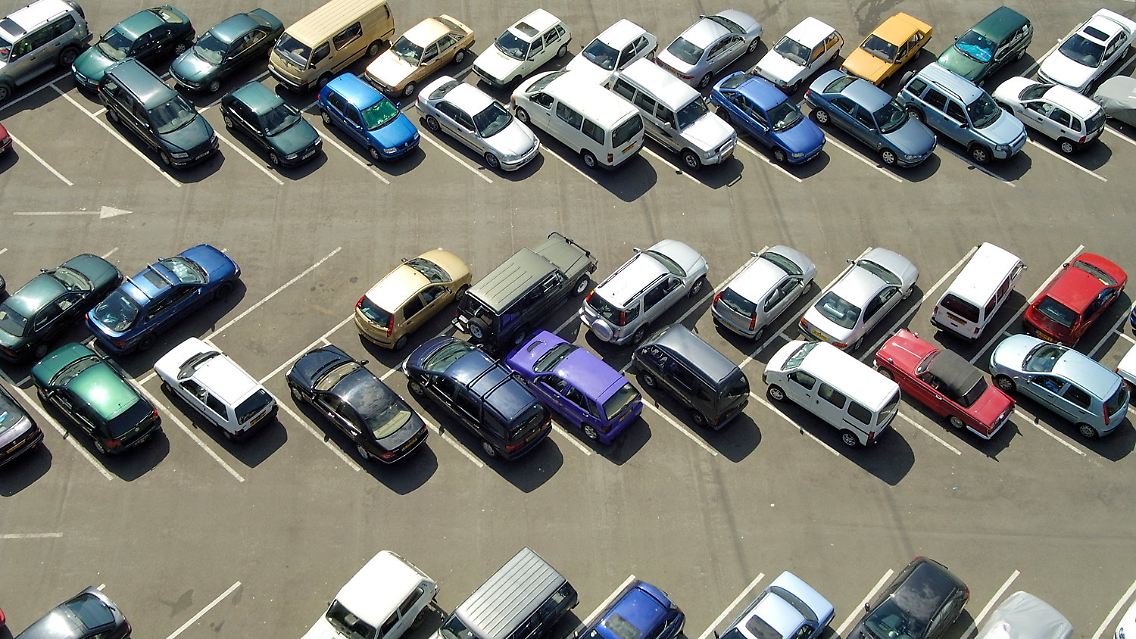Die Kolumne zum Automarkt Darwins Auslese in der PS-Branche
18.03.2013, 09:41 Uhr
Gumpert Apollo S: Heiße Kurven, scharfe Kanten und viel PS.
(Foto: picture alliance / dpa)
Auf dem Genfer Autosalon präsentieren die Autohersteller ihre Visionen von der automobilen Zukunft. Vom viel gerühmten Genfer Frühling kann dabei aber keine Rede sein, zu wenig wirklich Innovatives ist zu sehen. Die Branche krankt noch immer am PS-Wahn. Das sieht zwar klasse aus, aber so mancher Hersteller steuert damit auf den Abgrund zu.

Helmut Becker schreibt als anerkannter Autoexperte und Volkswirt für teleboerse.de und n-tv.de eine monatliche Kolumne rund um den Automarkt.
Der 83. Genfer Automobilsalon hat es wieder einmal schonungslos offenbart: Darwins Theorie von der Selektion und Verdrängung der Spezies untereinander feiert in der Automobilindustrie fröhliche Urständ. Noch nie war das Angebot der globalen Automobilkonzerne so breit gefächert wie 2013 und noch nie war die Einfalt in der Vielfalt größer als im diesjährigen Genfer Frühling. Immer mehr Modelle basieren auf der gleichen Plattform - ganz nach dem Motto: Fast alles von fast jedem!
Zwar wurden im Vorfeld des Salons 130 Premieren angekündigt, doch echte Neuheiten waren rar. Und noch nie glänzte die Branche mit PS-stärkeren Nischenmodellen und Absurditäten für eine Kundschaft, die in der Regel schon ein schnelles Auto hat. Oder die aufgrund der zunehmenden Verkehrsballung und -dichte immer langsamer unterwegs ist. Oder die immer länger im Stau steht. Kurzgefasst: Vollgas voraus - aber wohin?
Eine bewährte Theorie
Am 12. Februar 2009 feierte die Welt den 200. Geburtstag von Charles Darwin. Der britische Naturforscher gilt heute unumstritten als Begründer der modernen Selektions- und Evolutions theorie in der Biologie. Warum lieferte Darwins Theorie eine so wunderbare Blaupause für das, was sich in der Weltautomobilindustrie bereits seit Mitte der 2000er Jahre und mit zunehmender "Grausamkeit" abspielt? Wo liegen die gemeinsamen Eckpunkte?
Als Kristallisationspunkt für die Ausformulierung seiner Selektions- und Verdrängungstheorie erwies sich das Wachstumsgesetz von Thomas Malthus. Die Theorie von Malthus geht von der Beobachtung aus, dass die Bevölkerungszahl (ohne Kontrolle oder äußere Beschränkung) exponentiell wächst, während die Nahrungsmittelproduktion nur linear zunimmt. Somit kann das exponentielle Wachstum nur für eine beschränkte Zeit aufrechterhalten werden. Irgendwann kommt es dann zu einem Kampf um die beschränkten Ressourcen. Darwin erkannte, dass sich dieses Gesetz auch auf andere Arten anwenden ließ und ein solcher Konkurrenzkampf dazu führen würde, dass vorteilhafte Variationen erhalten blieben und unvorteilhafte Variationen aus der Population verschwänden. Dieser Mechanismus der Selektion erklärte die Veränderung und auch die Entstehung von neuen Arten.
Darwin und die Automobilindustrie
Damit lieferte Darwin auch ein Theoriegebäude für die Entwicklungstrends in der Weltautomobilindustrie. Die Parallelität zwischen Darwins Erkenntnissen und dem heutigen Geschehen in der Weltautom obilindustrie sind nicht von der Hand zu weisen. Gab es in den 1920er Jahren in den Industrieländern weltweit noch über 300 selbständige Automobilhersteller, waren es 1960 noch 64, 1970 noch 32 und bis 2013 ist diese Zahl inzwischen auf 12 geschrumpft.
Der Grund für das Verschwinden einzelner Spezies ist der Umstand, dass das Automobil nach 125 Jahren Siegeszug rund um den Globus an die Grenzen des Wachstums stößt. Die vorhanden terrestrischen Weidegründe beginnen in Summe - nicht für jeden einzelnen Hersteller - knapp zu werden. Das "Futterangebot" reicht nicht mehr für alle. Doch anstatt das Gehirnschmalz der Entwicklungsingenieure nunmehr verstärkt darauf zu lenken, wie man mit dem knapperen Futter effizienter umgehen könne, konzentrieren sich alle darauf, was man den verwöhnten und wohlhabenden Kunden in der "Alten Welt" denn noch alles in Varianten und PS anbieten könne, um sie zum Ersatzkauf zu verführen.
Von "E" zu "i" und Qoros
Alles überragende Neuheiten und innovative Konzepte waren auf dem diesjährigen Genfer Salon am Lac Léman Mangelware, und wenn es sie gab, so kamen sie aus Deutschland. Wie zum Beispiel das Einliter-Fahrzeug XL 1 von Volkswagen, das zumindest ein Zeichen für Zukunftsfähigkeit setzte. Sehr innovativ und zukunftsweisend waren vor allem auch die neuen i-Fahrzeugkonzepte von BMW mit dem BMW i3 und i8, bei denen sündhaft teure Carbon-Karossierien mit Elektroantrieben kombiniert werden. Sonst war vom E-Hype der vergangenen Jahre nicht mehr viel zu spüren, was man schon an der Lackierung der Exponate ablesen konnte. Audi hatte bereits im Vorfeld die Weiterentwicklung entsprechender "-E-Tron"-Modelle sang- und klanglos eingestellt.
Im Gegensatz zu diesen Innovationsträgern hat ein Alltagsfahrzeug im Vorfeld des Autosalons bereits viel Furore gemacht. Es kommt aus China und soll den ohnehin gesättigten Markt in Europa aufmischen. Der Qoros, so der Name, kann durchaus als Beleg für Darwins These dienen, dass besser angepasste Spezies auch bei knappem Futterangebot eine Überlebenschance haben.
Daraus eine fundamentale Gefährdung der westlichen Automobilhersteller durch die chinesische Automobilindustrie abzuleiten, wäre jedoch nicht angebracht. Wohl aber kann der Qoros als Beleg dafür dienen, dass internationale Kapitalgeber mithilfe deutscher Kaufleute, Designer und Ingenieure in der Lage sind, in China halbwegs konkurrenzfähige Automobile herstellen zu lassen. Mehr nicht! Darwins Theorie hebt der Qoros nicht aus den Angeln, wohl könnte er aber zu deren beschleunigter Umsetzung beitragen.
Quelle: ntv.de