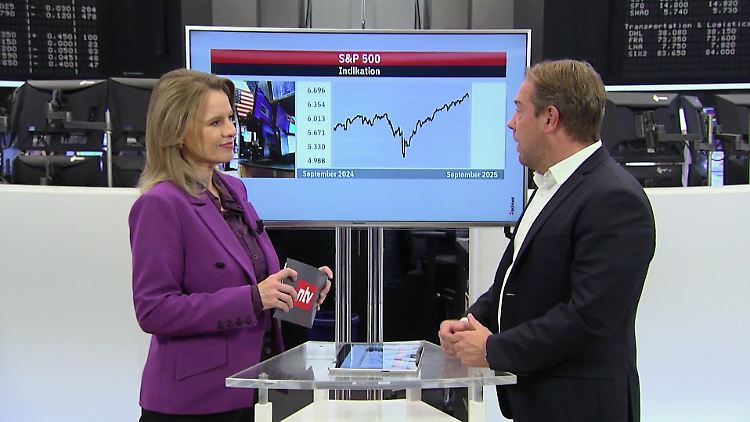Was wird aus der Konjunktur? Es geht, aber langsam
24.11.2009, 14:14 UhrNein, es ist kein Aufstieg wie dereinst Phoenix aus der Asche. Die deutsche Konjunktur zeigt im Herbst dieses Jahr eher Malocher-Qualitäten und arbeitet sich aus der Depression. Trotz aller Unwägbarkeiten verdichten sich die Zeichen für einen Aufschwung im kommenden Jahr – stetig, aber langsam.

Überall in Deutschland hoffen Budenbesitzer, Einzelhändler und Glühweinverkäufer auf konsumfreudige Passanten.
(Foto: picture-alliance/ dpa)
Man hat die deutschen Wirtschaftsforscher schon mal euphorischer gesehen. Dabei haben sie in diesen Tagen eigentlich in der Hauptsache Gutes zu vermelden. Der ifo-Index übertrifft die Erwartungen bei weitem, das Bruttoinlandsprodukt steigt und auch die Ergebnisse der Herbstumfrage des Forschungsinstituts IW stimmt im Grunde optimistisch. Was ist es also, das die Auguren der Wirtschaft so verhalten bleiben lässt?
Man könnte natürlich anführen, dass die Hoffnungssignale just aus der Feder derjenigen stammen, die die Katastrophe der Finanzkrise nicht haben kommen sehen und bis in den Herbst 2008 Erfolgsmeldungen vom Stapel ließen, als es in den USA auf dem Immobilienmarkt schon lichterloh brannte. Aber damit würde man den Forschern eine gewisse Ungenauigkeit unterstellen, was wohl nicht rechtens wäre. Vielmehr darf man glauben, was nahezu alle Prognostiker der deutschen Wirtschaft als Ursache für die Zurückhaltung anführen: Es gibt noch zu viele Fragezeichen hinter den guten Wirtschaftsdaten.
Für Deutschland wäre da zum Beispiel die wacklige Binnenkonjunktur. Fast alle Prognosen gehen von einer gesteigerten Arbeitslosigkeit 2010 aus. Noch vor wenigen Wochen geisterten Horrorzahlen von fünf Millionen Erwerbslosen und mehr durch die Medien. Ganz so schlimm dürfte es wohl nicht kommen, aber es schwebt mit der andauernden, flächendeckenden Kurzarbeit ein Damoklesschwert über dem Arbeitsmarkt. Nahezu alle Experten gehen davon aus, dass ein guter Teil der Kurzarbeiter im kommenden Jahr betriebsbedingt auf die Straße gesetzt werden könnte. Wie viele das sein werden, hängt von der Intensität des Aufschwungs ab. Das IW rechnet mit einer Zahl von 4,2 Millionen im Jahresdurchschnitt.
Unsicherheitsfaktor Konsum
Solche Zahlen schlagen sich direkt im Konsum nieder. Denn gerade die einkommensschwächeren Gruppen haben einen überdurchschnittlichen Anteil an den Konsumausgaben in Deutschland. Sie sind gezwungen, einen größeren Anteil ihrer Ausgaben für Einkäufe des täglichen Bedarfs aufzuwenden und können weniger sparen. Fehlt da das Geld, dann geht als direkte Folge die Binnennachfrage in die Knie. Zudem ist die Zahl der Geringverdiener naturgemäß höher als die Zahl der Beschäftigten mit höheren Einkommen. Das diesjährige Weihnachtsgeschäft dürfte ein erster Gradmesser werden, wie stark die Binnennachfrage wirklich ist.

Die Konjunktur in China in beeinflusst auch in ganz erheblichem Umfang die deutsche Wirtschaft.
(Foto: picture-alliance/ dpa)
Dazu gesellt sich die Problematik der weltweiten Ungewissheiten, die den Exportweltmeister Deutschland besonders belasten. Wenn in China der sprichwörtliche Sack Reis umfällt, dann beeinflusst das unsere Wirtschaft durchaus. Die Frage ist nur, wie stark. Beispiel Immobilienmarkt. Jüngst schlug die chinesische Notenbank Alarm, dass eine neue Blase entstehen könnte. Der Staat fördert den Bau-Boom ungebremst, was die Preise auf niedrigem Niveau hält. Es ist viel billiges Geld im Markt, was die Währungshüter nervös werden lässt. Wenn die Blase in China platzt, wird das die deutsche Wirtschaft direkt in Mitleidenschaft ziehen.
Billiges Geld ist ein Droge
Dabei steht die chinesische Notenbank vor dem selben Dilemma wie derzeit alle anderen Notenbanker auch. Die Weltwirtschaft ist überflutet mit billigem Geld. Den Geldhäusern stehen Massen an Geldreserven zur Verfügung, die diese derzeit in der Hauptsache für die Stärkung der eigenen Kapitaldecke nutzen.
Auf Dauer ist der Geldüberschuss ein Problem. Es droht eine Inflation. Das kann nur gut gehen, wenn die Zinsen rechtzeitig wieder anziehen. Genau das traut sich aber keine Notenbank. Es steht zu befürchten, dass das zarte Pflänzchen Konjunktur unter die Räder kommen könnte. Die Wirtschaftsexperten in aller Welt stehen deshalb vor der Frage, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, die exzessive Geldpolitik zu beenden. Die Zinsen müssen rauf, aber wie stark und wann ist aber unklar. Das könnte vielleicht die größte der Unwägbarkeiten für die Weltwirtschaft sein.
Gefahr für den Bundeshaushalt
Auch wenn für die Euro-Zone die Geldpolitik in der Europäischen Notenbank (EZB) gebündelt ist, steht Deutschland selbst vor dem Dilemma, zumal höhere Zinsen direkten Einfluss auf den Haushalt der Bundesregierung hätte. Die enormen Schulden, die die Vorgänger-Regierung im Zuge der Krisenbekämpfung angehäuft hat, haben das Potenzial, den Haushalt untragbar zu machen. Steigen die Zinsen allgemein, dann erhöht sich auch der Posten für die Zinslast im Bundeshaushalt signifikant. Und damit stünde die Fiskalpolitik vor der nächsten Klemme, nämlich Steuererhöhungen durchpeitschen zu müssen um den EU-Richtlinien wenigstens einigermaßen entsprechen zu können. Das dürfte der FDP nicht gefallen.
Gute Gründe also für die Wirtschaftsforscher, ihre Prognosen eher defensiv auszurichten. Auch wenn der Optimismus in der deutschen Wirtschaft wächst, volkswirtschaftlich gesehen gibt es noch einige Hürden zu überwinden. Wahrscheinlich ist aber auch richtig, dass die Wirtschaftskrise auch die Forschergemeinde etwas geerdet hat. Und das ist ja auch nicht das Schlechteste für künftige Zeiten. Schließlich hat die übertriebene Euphorie vor der Krise auch ihren Teil zur Eskalation beigetragen. Lassen wir uns künftig lieber positiv überraschen.
Quelle: ntv.de