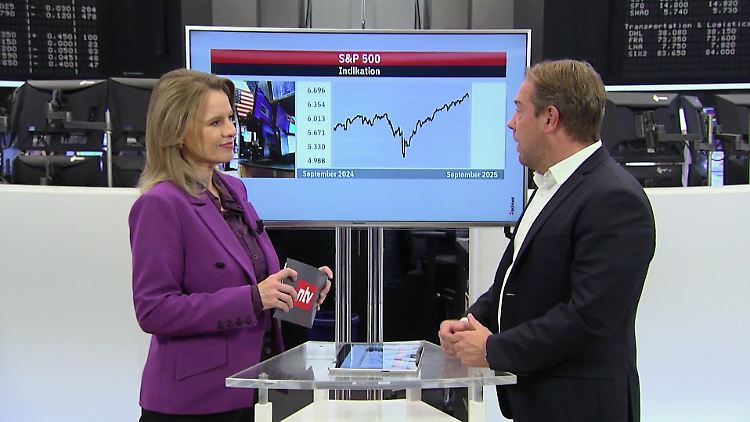Hochfrequente Kehrtwende Goldman forciert High-Speed-Handel
13.06.2015, 04:53 Uhr
Bei Hochfrequenzgeschäften geht es darum, sich durch Geschwindigkeit Vorteile an den Finanzmärkten zu verschaffen. Hedgefonds und Investmentbanken kämpfen in einer High-Tech-Schlacht um Bruchteile von Sekunden. Nun will auch Goldman Sachs groß mitmischen.
Goldman Sachs vollzieht eine Wende beim umstrittenen Thema Hochfrequenzhandel. Die US-Investmentbank plane, kräftig in Personal und Technologie zu investieren, um in diesem Geschäftsfeld anzugreifen, berichtete der Finanzdienst Bloomberg unter Berufung auf eingeweihte Kreise. Dabei hatte die Wall-Street-Firma im letzten Jahr noch eine schärfere Regulierung gefordert. Die Risiken an den Finanzmärkten würden durch den dramatischen Anstieg automatisierter High-Speed-Geschäfte verstärkt, warnte Goldman-Präsident Gary Cohn im März 2014 in einem Meinungsbeitrag im "Wall Street Journal".
Nun sei die Bank dabei, Software aufzurüsten und einen auf High-Tech-Handelssysteme spezialisierten Top-Manager vom Rivalen Morgan Stanley abzuwerben. In den nächsten Monaten solle das Team weiter aufgebaut werden. Eine Sprecherin wollte sich nicht äußern.
Ganz überraschend käme die Offensive allerdings nicht: Im Januar hatte Goldman Sachs bereits einen Experten vom Hochfrequenzhändler Allston Trading als Verstärkung gewinnen können. Im April beteiligte sich die Bank zudem mit 20,5 Millionen Dollar an Perseus, einer Firma, die Turbo-Händler mit der Netzwerktechnik ausstattet.
"Flash Crash"
Automatisierte Handelssysteme, die bei ihren Wertpapierorders Algorithmen folgen, gehören an der Börse inzwischen zum Alltag. Experten warnen allerdings vor dem großen Einfluss der Handels-Roboter. Kommt es zu Panik an den Märkten, kann der Hochfrequenzhandel außer Kontrolle geraten und Kursentwicklungen heftig beschleunigen. Zudem gibt es auch den simplen Vorwurf, die Profi-Investoren seien durch ihre versierte Technik immer einen Schritt voraus, so dass Kleinanleger stets das Nachsehen hätten. Deshalb gab und gibt es bereits mehrere Ermittlungen der US-Finanzaufsicht sowie der New Yorker Staatsanwaltschaft und des Justizministeriums.
Auf das Konto des Hochfrequenzhandels geht in den vergangenen Jahren so manche Panne an der Wall Street. Im April 2013 legten zum Beispiel ein Software-Probleme die Derivate-Börse CBOE aus Chicago für einen halben Tag lahm. Im Sommer 2012 sorgte der US-Aktienhändler Knight Capital für Schlagzeilen. Knight-Rechner hatten damals unbeabsichtigt den Markt mit Orders geflutet und für Chaos gesorgt. Dem Unternehmen entstand ein Verlust von 440 Millionen Dollar. Das Handelshaus stand dadurch vor dem Kollaps, musste von mehreren Investoren gerettet werden. Mittlerweile ist es vom Makler Getco übernommen worden.
In Erinnerung ist an der Wall Street zudem noch der sogenannte Flash Crash aus dem Jahr 2010. Damals fiel der Kurs des Standardwerte-Index Dow Jones binnen Minuten um rund 1000 Punkte. Hier lösten Computerprogramme von Hochfrequenz-Händlern eine Verkaufskaskade aus, während deren der Preis für einige Aktien auf null Dollar fiel. Nach etwa einer halben Stunde war der Spuk vorbei - und der Dow fast wieder dort, wo er vor seinem Absturz gelegen hatte. Der Skandal hat die Turbohändler ins Visier der Regulierer gebracht, die die Daumenschrauben angezogen haben.
Die US-Justiz beschuldigt jedoch auch einen einzelnen Händler, den damaligen Crash ausgelöst zu haben. Der Brite Navinder Singh Sarao soll die Börse durch eigens manipulierte Software mit massenhaften Scheinaufträgen bombardiert und so das Chaos am Markt verursacht haben. Der 36-Jährige wurde im April in einem Londoner Vorort verhaftet und sitzt nun in einem britischen Gefängnis. Die USA werfen ihm Betrug und Manipulation vor und drängen auf seine Auslieferung. Sarao soll über Jahre Millionen mit seinen Tricks ergaunert haben.
Quelle: ntv.de, bad/dpa