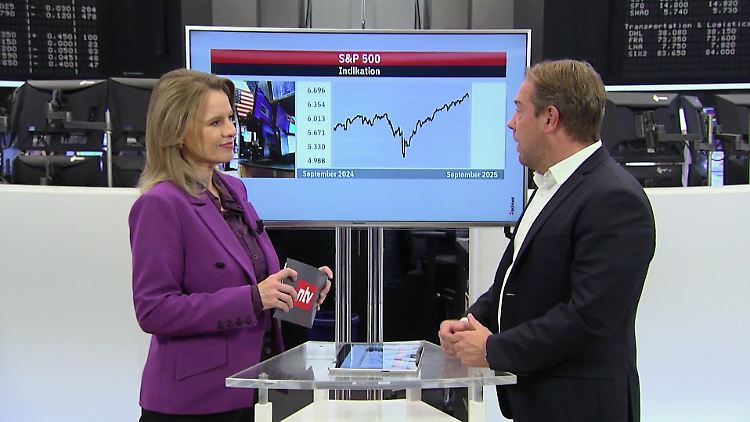Robuster Arbeitsmarkt Konjunktur zieht an
15.04.2010, 11:06 UhrDie deutsche Wirtschaft wird in diesem Jahr nach Ansicht der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute um 1,5 Prozent wachsen. Zugleich warnen sie, dass sich die Lage in den öffentlichen Haushalten nochmals verschlechtern werde. Die Arbeitslosigkeit dürfte langsam sinken.
Die deutsche Wirtschaft kommt nach dem schärfsten Einbruch der Nachkriegsgeschichte langsam wieder in Schwung. Entgegen den bisherigen Befürchtungen zeigt sich der Arbeitsmarkt erstaunlich robust. Das geht aus dem Frühjahrsgutachten führender Wirtschafts- Forschungsinstitute hervor. Darin sagen die Top-Ökonomen für dieses und das kommende Jahr einen leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit voraus.
Die Wirtschaft wird nach der aktuellen Prognose in diesem Jahr moderat um 1,5 Prozent und im nächsten Jahr um 1,4 Prozent zulegen. Nach 2011 dürfte sich die wirtschaftliche Erholung leicht beschleunigt fortsetzen. Mittelfristig werde das Wachstum aber spürbar niedriger sein als vor der Krise erwartet worden war.
Kritik an Steuersenkungen
In ihrem aktuellen Konjunkturausblick verweisen die Institute weiter auf große Risiken. Zugleich warnen sie, dass sich die Lage in den öffentlichen Haushalten nochmals verschlechtern werde. Die Steuersenkungspläne der schwarz-gelben Koalition lehnen die Experten ab. Es sei ohnehin schwer genug, den angestrebten Schuldenabbau zu erreichen. "Daher ist es unrealistisch, derzeit Steuersenkungen zu erwägen", heißt es in dem gemeinsamen Gutachten. Es ist Grundlage für die nächste Konjunkturprognose der Bundesregierung und die für Anfang Mai mit Spannung erwartete Steuerschätzung.
"Die von den Instituten vorgeschlagene Haushaltskonsolidierung erfordert einen strikten Sparkurs, wie es ihn in der Bundesrepublik bislang noch nicht gegeben hat", empfehlen die Experten. In den kommenden fünf Jahren dürfen die Staatsausgaben deshalb kaum steigen, was zweifellos harte politische Entscheidungen erfordere. Die Finanzpolitik sollte nach Ansicht der acht Institute 2011 auf einen Konsolidierungskurs einschwenken. Die Konjunktur dürfte sich dann so weit gefestigt haben, dass ein Sparkurs nicht zu einem Rückfall in die Rezession führe. Das Regierungsbündnis aus Union und FDP diskutiert derzeit über die im Wahlkampf und im Koalitionsvertrag versprochenen Steuersenkungen. Die FDP will kleine und mittlere Einkommen um rund 16 Mrd. Euro entlasten.
Nach Einschätzung der Institute ist es bei Staatsausgaben von 1,2 Billionen Euro zwar nicht unmöglich, dies zu finanzieren. "Allerdings ist das Ziel der Haushaltskonsolidierung ohnehin schon schwer zu erreichen; daher ist es unrealistisch, derzeit Steuersenkungen zu erwägen", schrieben die Forscher. Denn man könne nicht darauf setzen, dass sich die Entlastungen - wegen der Mindereinnahmen - ausreichend selbst finanzierten. "Darüber hinaus können Steuersenkungen, die vor allem einzelne Gruppen begünstigen, die allgemeine Bereitschaft, den erforderlichen Sparkurs mitzutragen, untergraben."
Forderung nach Ausgabenkürzungen
Die Institute kritisieren, dass die Regierung bisher noch nicht konkretisiert hat, wie sie die Haushaltslöcher stopfen und die selbst auferlegte Schuldenbremse einhalten will. Die Forscher plädieren dafür, dass der Staat vor allem seine Ausgaben kürzt, um die Defizite abzubauen. Konkret schlagen sie vor, Steuervergünstigungen zu kappen. So sollte der ermäßigte Mehrwertsteuersatz für kulturelle Leistungen, für den Personennahverkehr und für Übernachtungsdienstleistungen abgeschafft werden. Die Koalition hatte erst zum Jahresanfang 2010 die Hoteliers entlastet, was ihr von vielen Seiten heftige Kritik eingebracht hat.
Zudem schlagen die Forscher vor, Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit künftig zu besteuern. Einsparmöglichkeiten bestünden auch bei den Personal- und den Sachausgaben: Hier sollten moderate Lohnanstiege vereinbart und die Effizienz im öffentlichen Sektor gesteigert werden. Zudem gebe es im Gesundheitssystem noch Effizienzreserven, die ausgeschöpft werden sollten. Die Institute favorisieren unter anderem, dass die Beiträge für die gesetzliche Krankenversicherung im nächsten Jahr um 0,3 Punkte auf 15,2 Prozent steigen sollten.
Kritik am Rettungspaket
Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute übten harsche Kritik am Rettungspaket der Euro-Länder und des Internationalen Währungsfonds (IWF) für das hoch verschuldete Griechenland. Eine solche Hilfe widerspreche dem Geist des Vertrags von Maastricht, hieß es in dem Frühjahrsgutachten. Die Forscher sprachen sich dafür aus, dem IWF die Hauptrolle zu geben. Der IWF könne glaubwürdiger als eine EU-Einrichtung drohen, dass Finanzhilfen zurückgehalten werden, wenn Auflagen nicht erfüllt würden. Außerdem habe der Fonds große Erfahrungen bei der Organisation von Rettungsprogrammen für Staaten.
"Zudem darf dies nicht der Einstieg in eine Transferunion sein", mahnten die Forscher. Um einen Vertrauensverlust für den gesamten Euroraum zu verhindern, müssten Rettungsmaßnahmen so ausgestaltet sein, dass sie langfristig keine kontraproduktiven Anreize setzten. Ein Mechanismus, der Ländern des Euroraums bei Finanzierungsproblemen regelmäßig Hilfszahlungen der anderen Länder beschere, sei kontraproduktiv: "Die Wahrscheinlichkeit der Notwendigkeit von Finanzhilfen stiege und notwendige Anpassungsprozesse würden verzögert oder gar unterdrückt - mit der Gefahr, dass sich die Notwendigkeit von Hilfszahlungen verstetigt."
Allerdings bürgen ernsthafte Zahlungsschwierigkeiten große Gefahren für den gesamten Euroraum: So könne es in der gegenwärtigen Verfassung des Finanzsystems zu einem erneuten allgemeinen Vertrauensverlust kommen. "Diese Verwerfungen würden die noch fragile realwirtschaftliche Entwicklung im gesamten Euroraum belasten und damit große volkswirtschaftliche Kosten mit sich bringen", schrieben die Forscher. Sollte es sogar zum Zahlungsausfall Griechenlands kommen, könnte das die ohnehin angespannte Lage der Banken verschärfen und weitere staatliche Rettungsprogramme notwendig machen. "Angesichts des Konsolidierungsbedarfs in den meisten Mitgliedsländern des Euroraums dürften die Regierungen vor großen Schwierigkeiten stehen, diese Kosten zu stemmen."
Quelle: ntv.de, dpa/rts