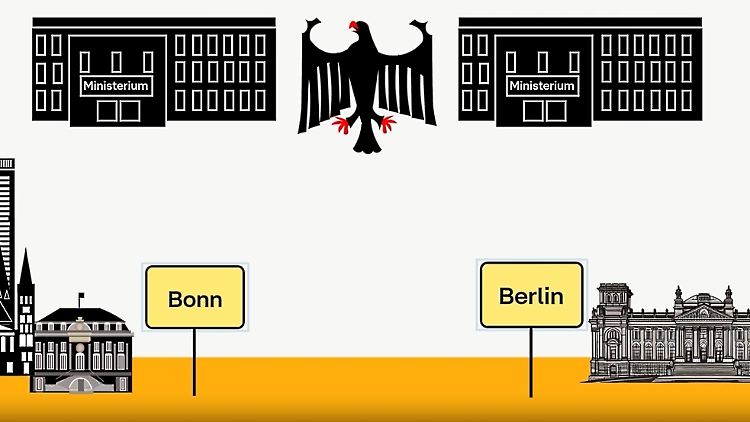Inside Wall Street Alle auf die Kleinen
12.06.2013, 06:29 Uhr
Bernhard "Bernie" Madoff.
(Foto: picture-alliance/ dpa)
Er muss es ja wissen: Bernie Madoff beklagt, dass Kleinanleger an der Börse über den Tisch gezogen werden. Besonders bitter: Für viele US-Amerikaner ist es schon schwer genug, überhaupt das nötige Geld zusammenzubekommen, um es am Aktienmarkt zu investieren.
Es mag ja spannend sein, Tag für Tag die Bewegungen an den Börsen zu verfolgen – doch für den größten Teil der Bevölkerung spielt das Auf und Ab an der Wall Street längst keine Rolle mehr, denn sie investieren nicht mehr. Das hat zwei Gründe: Viele US-Amerikaner haben das nötige Spielgeld nicht und viele wissen längst, dass sie im Spiel mit den Großinvestoren ohnehin keine Chance haben.
Wer sich im Vergleich zu Banken und Hedgefonds machtlos wähnt, bekommt dieser Tage ausgerechnet von Bernie Madoff Unterstützung. Der prominente Anlagebetrüger, der Mann hinter dem größten Schneeball-System aller Zeiten, der Banker, der Milliarden veruntreute und zur Zeit eine 150-jährige Haftstrafe absitzt, hat sich im Interview mit dem US-amerikanischen Finanznachrichtendienst Marketwatch ein wenig Frust von der Seele geredet. "Der Einzelinvestor ist immer der letzte, der irgendetwas erfährt", sagt Madoff, und dass der Handel dem kleinen Mann gegenüber von Grunde auf unfair sei. Mit strengeren Regeln und mehr Überwachung wäre dem Problem unter Umständen beizukommen – "dann hätte man auch mich früher gefasst" – doch schwierig werde das Umfeld für private Anleger immer bleiben. "Betrug am Kleinanleger hat es immer gegeben, und ich glaube nicht, dass das so bald aufhören wird."
Höherer Mindestlohn wäre hilfreich
So weit Madoff, so weit das Problem des mangelnden Vertrauens in den Markt. Mindestens genau so schwer wirkt allerdings, dass es dem Kleininvestor am nötigen Kapital mangelt, das am Aktienmarkt eingesetzt werden kann. Statistiken zeigen – und sind hier und an anderer Stelle oft diskutiert worden –, dass die soziale Ungleichheit in den USA größer ist als in vergleichbaren Industrienationen. Auch das wird sich sobald nicht ändern, wie ein Blick nach Washington zeigt.
Da haben die Republikaner vor einigen Wochen einen weiteren Versuch niedergeschlagen, den Mindestlohn für Arbeiter zu erhöhen. Höhere Mindestlöhne würden letztlich Arbeitsplätze kosten, so das ewige Argument der Rechten. Einen statistischen Beleg gibt es dafür nicht, und angesichts der rasant wachsenden Unternehmensgewinne in den letzten Jahren spricht auch sonst nichts dafür, dass ein solcher Job-Stopp drohen könnte. Im Gegenteil: Höhere Mindestlöhne, so das Argument von Volkswirten und den demokratischen Befürwortern, dürften aus mehr oder minder verarmten Bürgern wieder Verbraucher machen und damit die Wirtschaft stärken – das käme letztlich wieder den Unternehmen zugute.
Obama unternimmt neuen Versuch
Aktuell liegt der Mindestlohn in den USA bei 7,25 Dollar pro Stunde – und zwar seit 2009. Auch zuvor war das Niveau jahrelang nicht angehoben worden. Hätte der Kongress den Mindestlohn in den letzten zwanzig Jahren parallel zur Produktivität der Arbeiter steigen lassen, dann läge er heute bei 21,72 Dollar pro Stunde – fast dreimal so hoch wie das tatsächliche Niveau. Es ist nicht unsinnig zu denken, dass die US-amerikanische Wirtschaft einen großen Teil ihrer Probleme in den letzten Jahren hätte umschiffen können, wenn die Verbraucher zwischen New York und Kalifornien mit höheren Gehältern ausgestattet und entsprechend weniger von staatlicher Hilfe und von Krediten abhängig gewesen wären.
Auf diese 21,72 Dollar will man den Mindestlohn gar nicht anheben, aber Präsident Barack Obama hatte in seiner Rede zur Lage der Nation zuletzt immerhin 9 Dollar versprochen. Im Kongress wurden zuletzt 10,10 Dollar abgeschmettert, und wann ein weiterer Gesetzentwurf zur Abstimmung kommt, ist offen. Damit bleibt die Schere zwischen Arm und Reich weiter gespreizt, doch das schadet letztlich allen: den Arbeitern, den Firmen, der Wirtschaft und der Börse, wo es irgendwann an Anlagekapital fehlen wird.
Quelle: ntv.de